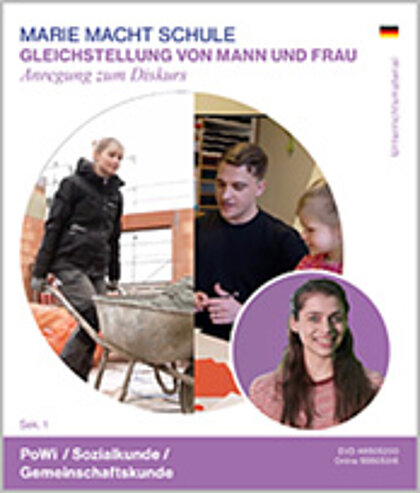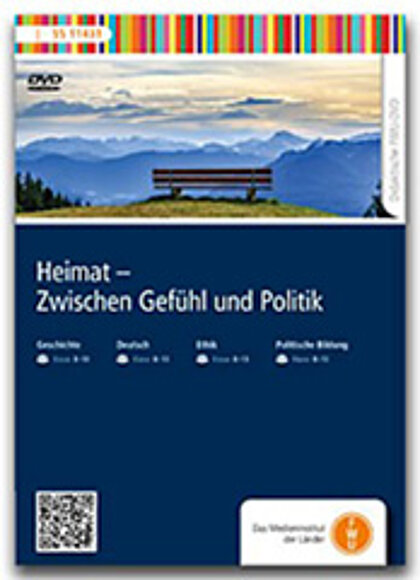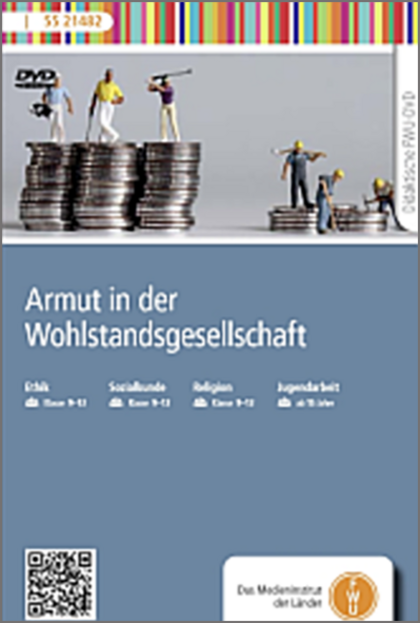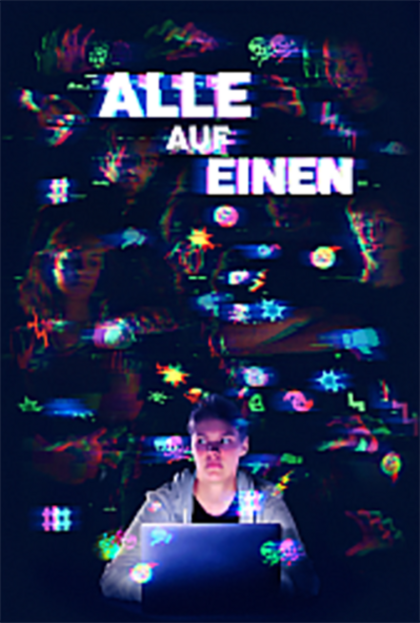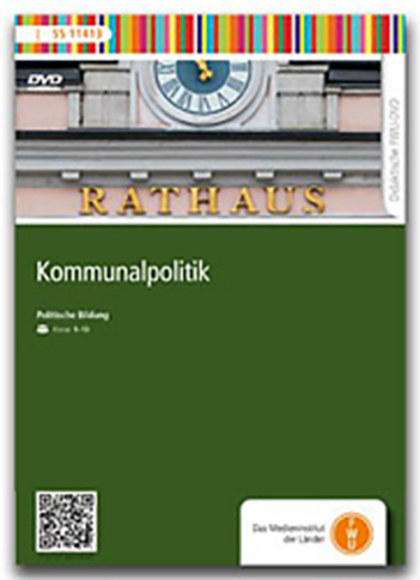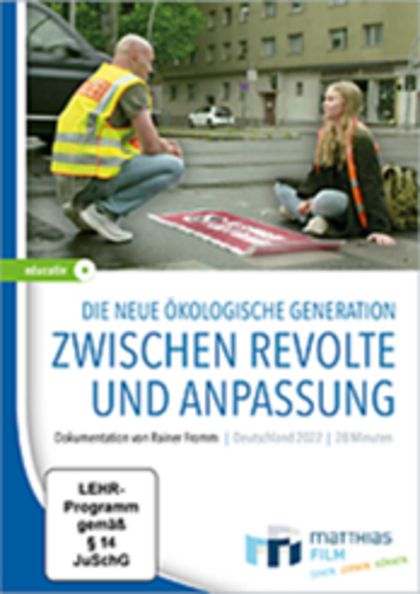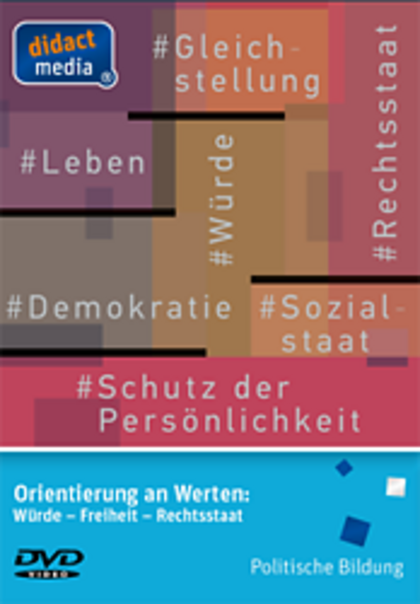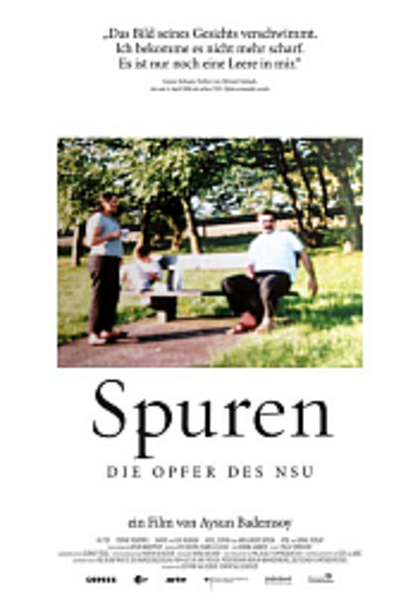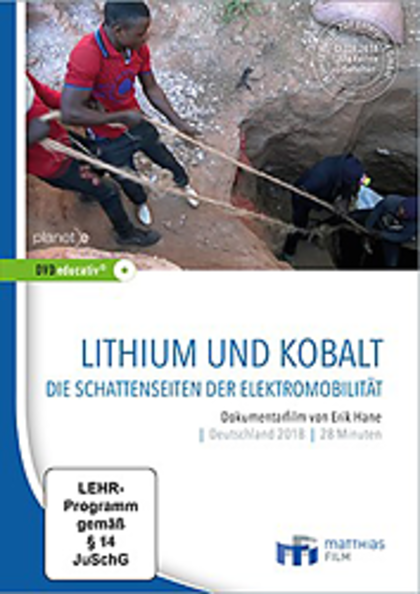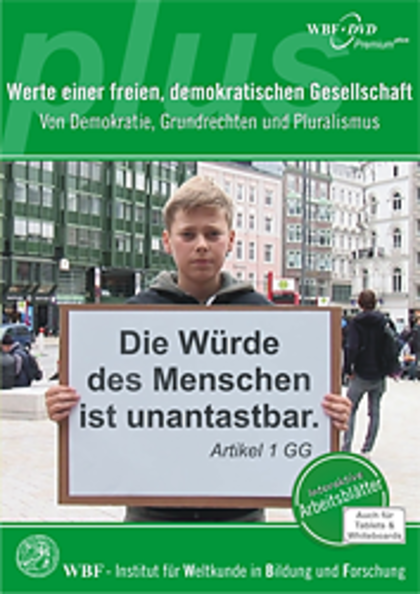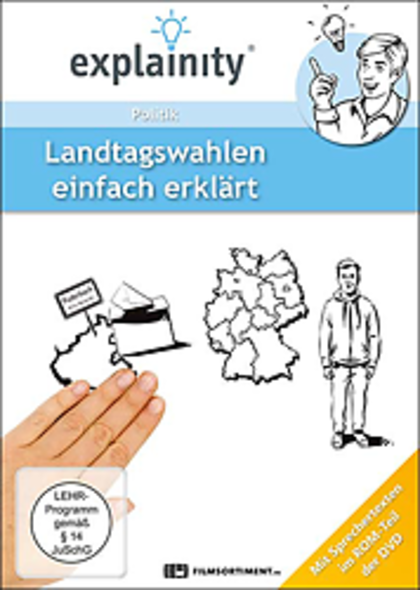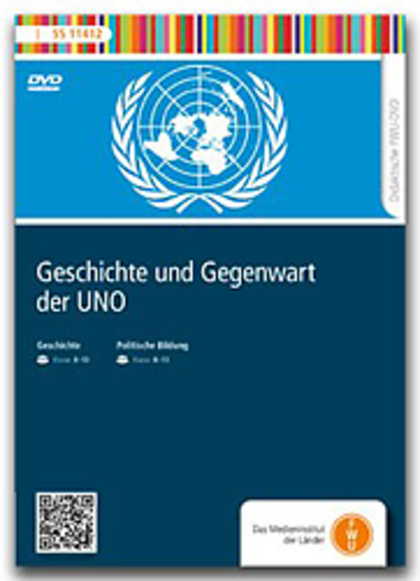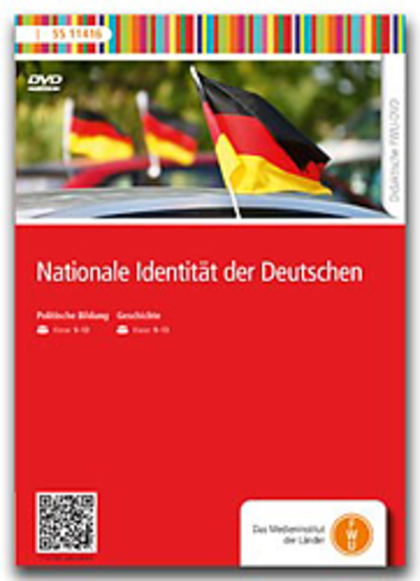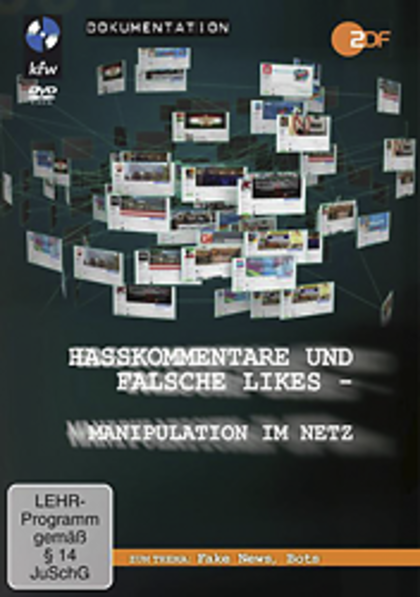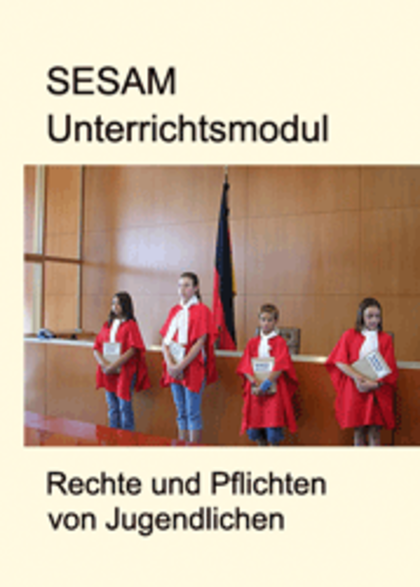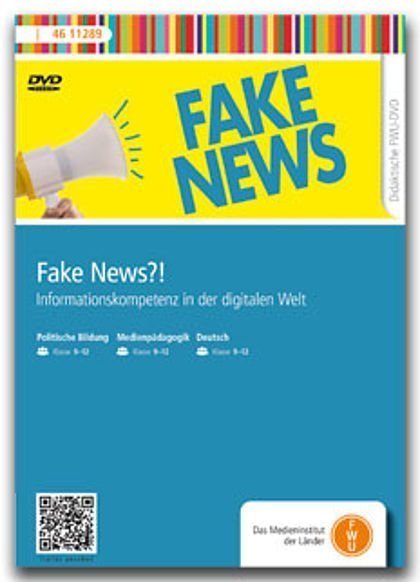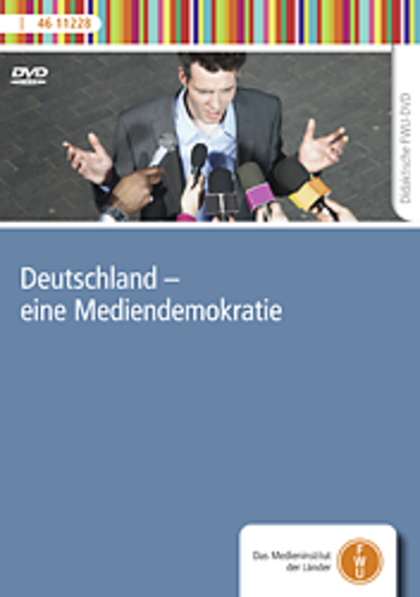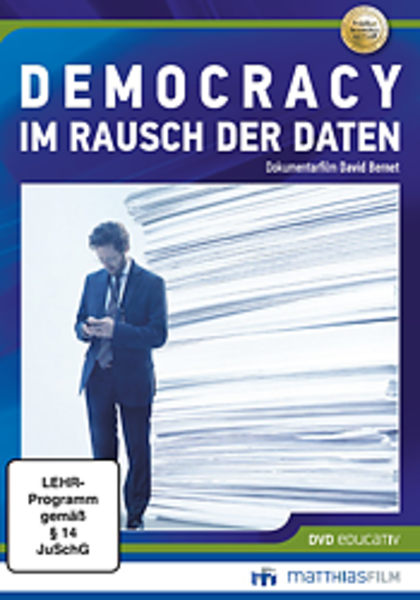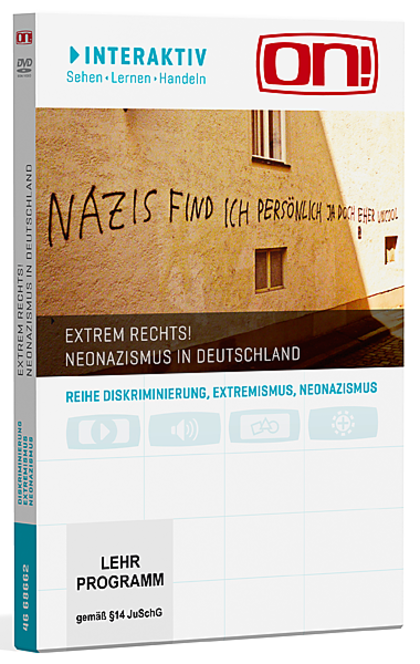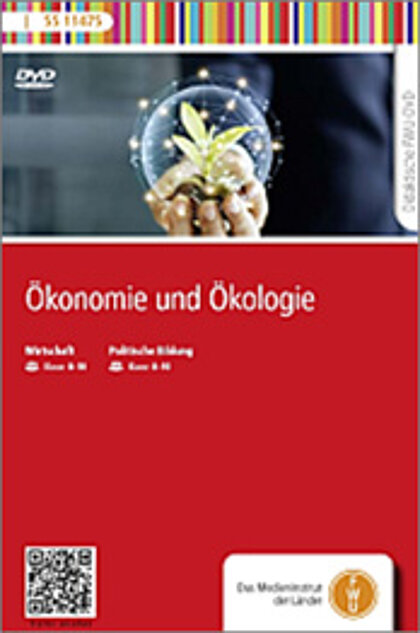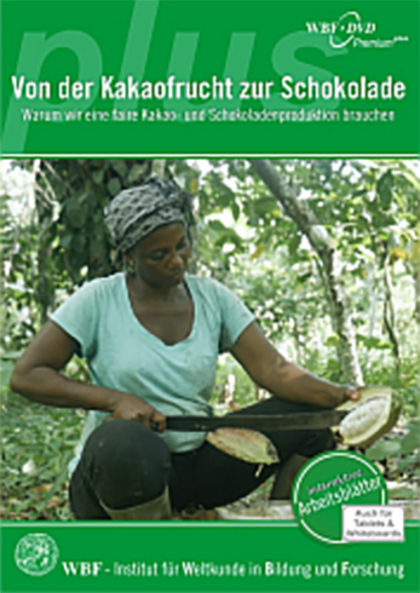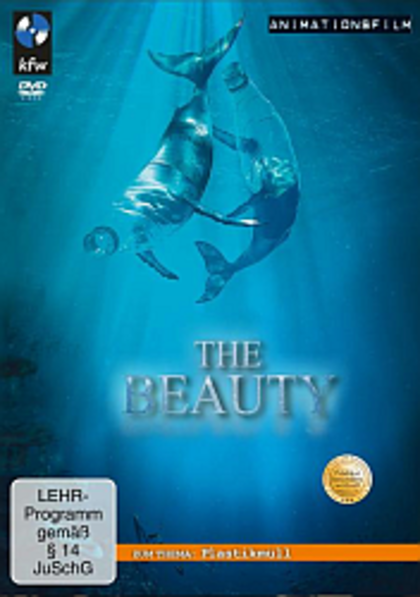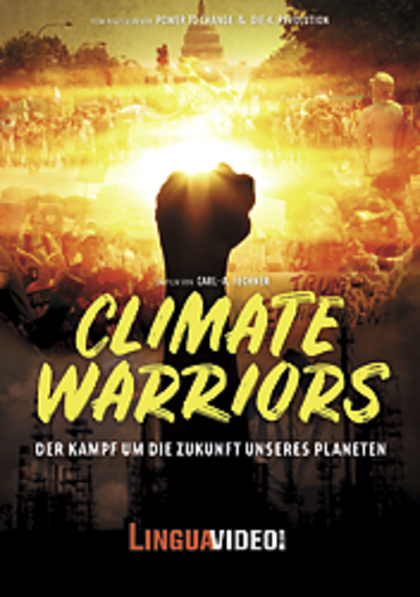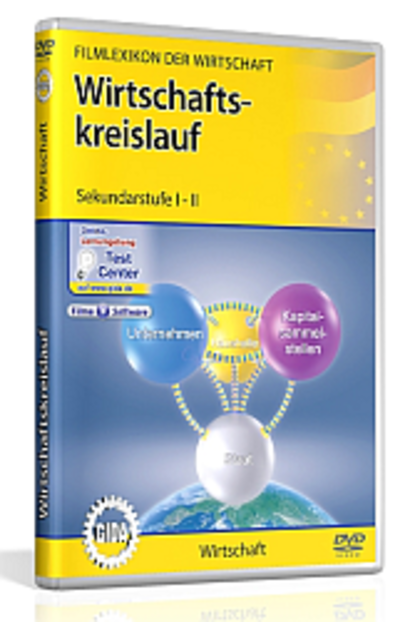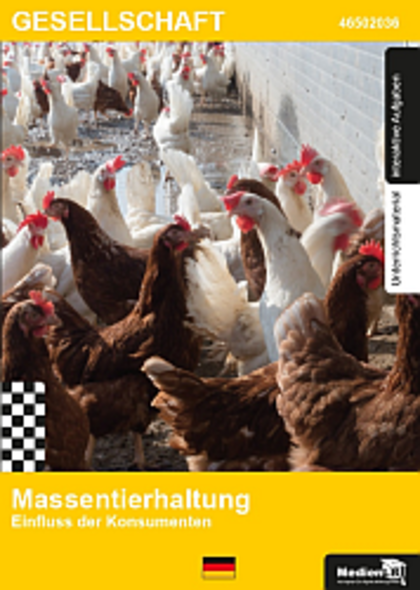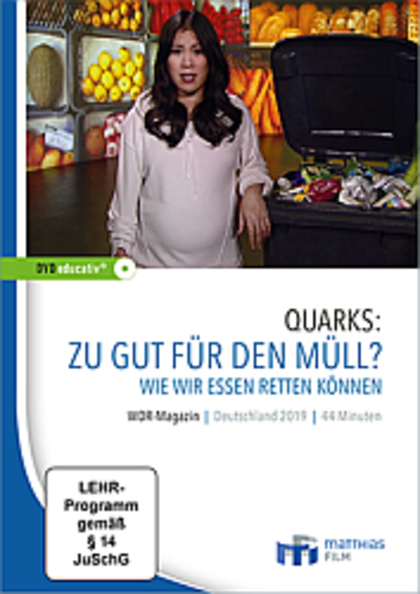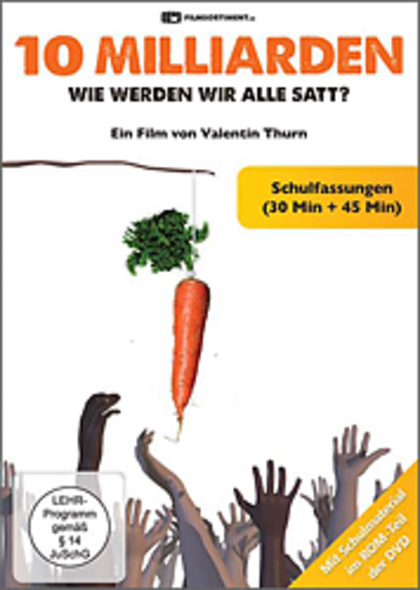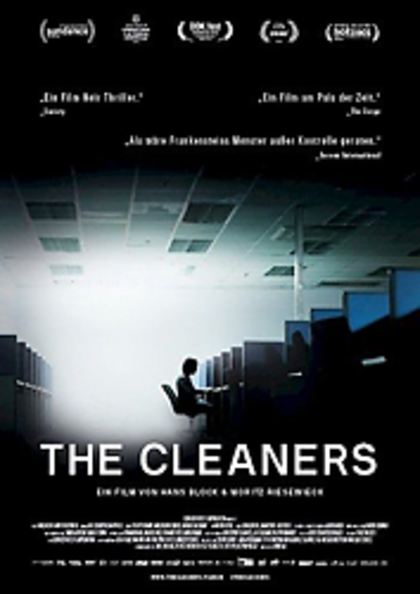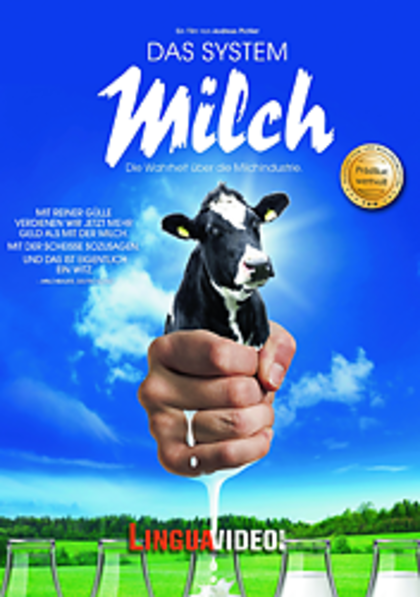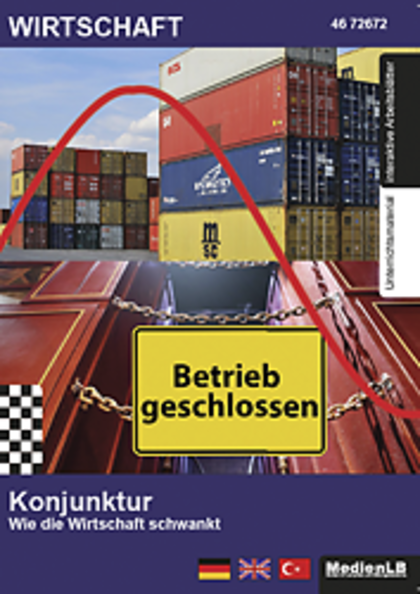Gemeinschaftskunde
Alle hier aufgeführten Medien und Materialien sind von den zuständigen Fachkommissionen der Medienbegutachtung für den schulischen Einsatz besonders empfohlen.
Diese Auflistung stellt nur eine kleine Auswahl der empfohlenen Filme in der SESAM-Mediathek dar. Viele der hier vorgestellten Filme sind landesweit verfügbar – aber leider nicht alle. Es kann also passieren, dass in Ihrem Medienzentrum der ein oder andere Film nicht genutzt werden kann.
GettyImages/Alengo
Klasse 8–10
For Future 2
Die 15 umweltpolitischen Kurzfilme behandeln die Schwerpunkte Tierwohl, Umweltzerstörung, Klimapolitik, nachhaltiges Handeln und Konsum. Ehrlich reflektieren junge Menschen in den Filmen ihr starkes Umweltbewusstsein. Es kann erarbeitet werden, welchen Mehrwert die Aktivisten und Aktivistinnen aus ihren Aktionen für ihr eigenes Leben ziehen und ob die gezeigten Aktionen geeignet sind, auch politisch etwas zu bewegen.
Umwelt-Aktivismus und Klimagerechtigkeit
Jungen Klimaaktivisten bieten Identifikationsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler, um ihr eigenes Verhalten in Bezug auf die Klimakrise zu hinterfragen. Verschiedene offene und geschlossene Aufgabentypen auf Englisch knüpfen an das Thema an, wodurch sich Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten entwickeln, die weiter vertieft werden können. Der gesprochene Text des Mediums ist gut verständlich, aber anspruchsvoll und das thematische Vokabular sollte im Vorfeld vorentlastet werden.
Gleichstellung von Mann und Frau
Dem Medium gelingt es Rollenklischees zu thematisieren und den Zusehern vor Augen zu führen, dass viele noch in diesen Klischees verhaftet sind. Indem Passanten zu Wort kommen und ihre Sicht auf Gleichstellung von Mann und Frau schildern, problematisiert der Hauptfilm festgefahrene Rollenbilder als immer noch fest verankert in der Gesellschaft. Eine Maurerin und ein Erzieher werden vorgestellt und berichten, was sie zur Berufswahl bewogen hat. Dies kann als Diskussionsgrundlage zum eigenen Rollenverständnis dienen.
Heimat - Zwischen Gefühl und Politik [interaktiv]
Das Medium bietet eine Betrachtung des Begriffes von Heimat im historischen sowie in verschiedenen aktuellen Kontexten. Diese differenzierte Betrachtung ermöglicht es, im Unterricht die Verwendung des Begriffes kritisch zu betrachten und eigene Positionen zu beziehen. In Zeiten zunehmender Globalisierung und Migration taucht der komplexe Begriff „Heimat" wieder vermehrt in aktuellen Debatten auf. Dabei wird er von verschiedenen Seiten vereinnahmt und teilweise auch missbraucht. Neben der Verwendung des Begriffes „Heimat“ auf Produkten des täglichen Lebens wird insbesondere die gesellschaftspolitische Wirkung des zunehmenden Gebrauchs auf Wahlplakaten konservativer und rechtsextremer Parteien und Gruppierungen thematisiert.
Armut in der Wohlstandsgesellschaft [interaktiv]
Es wird nachvollziehbar, dass es in unserer Wohlstandsgesellschaft keine Armut geben müsste, und die Fragen zu Wirksamkeit und Begrenzungen der staatlichen Maßnahmen werden so gestellt, dass Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert sind, Position zu beziehen und ihren Gerechtigkeitsbegriff zu hinterfragen. Das vielseitige und aspektreiche Arbeitsmaterial zielt dementsprechend nicht nur auf Wissensvermittlung, sondern möchte über Einfühlung und Perspektivwechsel Schülerinnen und Schüler zu sozialem Engagement anregen.
Alle auf einen
Diskriminierung im Internet verbreitet sich immer mehr, besonders in sozialen Netzwerken, Foren und Kommentarspalten. Doch wie ordnen junge Menschen den aggressiven Umgangston, Beleidigungen und Diffamierungen in der Netzsprache ein? Die manchmal sehr konträren Ansichten der interviewten Jugendlichen im Hinblick auf Netiquette versus Hate bieten einen guten Gesprächsanlass.
Kommunalpolitik
Kommunalpolitik wird in diesem Medium sehr anschaulich präsentiert. Der Film begleitet Jugendliche durch das Planspiel „Pimp your town“ im niedersächsischen Bad Bentheim. Dabei wird die Thematik durch häufigen Gegenschnitt von Sitzungen des Gemeinderates und den Sitzungen der Jugendlichen im Planspiel sehr plastisch und nachvollziehbar. Das Planspiel kann die Jugendlichen zur politischen Teilhabe motivieren.
Soziale Medien
Die Reportage stellt in kontroverser Form drei "Rich Kids" vor und lässt Psychologen und Eltern zu Wort kommen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Verhalten in sozialen Medien und auf die Ungleichverteilung von Wohlstand und Chancen. Die Persönlichkeit und die Aussagen der jungen Protagonisten fordern zum Formulieren des eigenen Standpunkts heraus.
Die neue ökologische Generation
Mit Aktionen, Blockaden und Besetzungen erlebt Deutschland Jahrzehnte nach der Friedensbewegung und der Anti-Atombewegung wieder eine große Protestwelle. Der Film stellt neue ökologische Bewegungen von "Fridays for Future" bis "Letzte Generation" vor, die auf unterschiedliche Weise versuchen, einen zügigen Wandel voranzutreiben, um die Klimakatastrophe doch noch einzudämmen und kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Er beleuchtet unter anderem den Aspekt der Klimagerechtigkeit und wirft die Frage auf, welche Methoden der Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen angemessen und zielführend sein können und wie weit der zivile Ungehorsam angesichts der Dringlichkeit der Lage gehen darf.
Orientierung an Werten
Der Film beschäftigt sich mit dem Boden, auf dem unsere Demokratien stehen. Ein fester Boden unserer Geschichte und Kultur. Die Basis für unsere Freiheit, Entfaltung und Schutz der Persönlichkeit und Freizügigkeit in Europa. Unter den Stichworten: Würde, Leben und Unversehrtheit, Rechts- und Sozialstaat, Gleichstellung, Persönlichkeits- und Bürgerrechte sowie Demokratie wird ein Querschnitt durch unseren Wertekanon abgebildet und die Bedeutung der Grundwerte an zahlreichen alltäglichen Beispielen sichtbar gemacht. Das Medium vermittelt auch den Rahmen durch europäische Verfassungen, Grund- und Menschenrechte, UN-Konventionen, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Europäische Menschenrechtskonvention. Es wird darauf eingegangen, dass diese Werte gegen zunehmend populistische, autoritäre und demokratiefeindliche Bewegungen und politische Akteure geschützt werden müssen. Ein Stilmittel des Mediums sind Fragestellungen beispielsweise nach einem Leben ohne diese Werte.
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Im Jahr 2015 beschlossen die Mitgliedsstaaten der UN die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. Ein Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise ist dringend notwendig. Dazu können wir alle beitragen, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verkleinern. Wir können aber auch unseren Handabdruck vergrößern, indem wir nachhaltiges Verhalten für möglichst viele Menschen einfacher machen. Wie das gelingen kann, zeigt der Film an einem Zero-Waste-Café, einem Unverpacktladen und einer Fairtrade-University.
Hongkong und Taiwan
Seit 2019 erschüttern Demonstrationen und Unruhen die einst so stabile Weltstadt Hongkong. Vor allem junge Hongkonger verlangen mehr demokratische Rechte. Immer mehr Einwohner Hongkongs gehen auf Distanz zur Volksrepublik China und eine Minderheit der Demonstranten provoziert China gar mit der Forderung nach Unabhängigkeit. Die wohl liberalste Gesellschaftsordnung in Asien genießen die 23 Mio. Bürger Taiwans. In den Augen Pekings ist Taiwan nur eine abtrünnige Provinz, die notfalls auch unter Waffengewalt mit dem Festland wiedervereinigt werden muss. Doch die Taiwanesen wollen weder ihre demokratischen Errungenschaften noch ihre Identität verlieren. Bei den Wahlen am 11. Januar 2020 erzielte die Chinakritische Präsidentin Tsai Ingwen einen deutlichen Sieg.
Spuren
Zwischen 2000 und 2007 ermordete die rechtsextreme Terrorgruppe NSU zehn Menschen, überwiegend türkische Migranten, die als Kleinunternehmer in Deutschland Fuß gefasst hatten. Der Dokumentarfilm lässt Hinterbliebene der Opfer ihre Erinnerungen teilen und erzählen, welche Spuren die Ermordeten hinterlassen haben.
Fakt oder Fake?
Informationen sind dank digitaler Medien überall und jederzeit verfügbar. Doch nicht alles, was geschrieben und gezeigt wird, ist wahr. Willi Weitzel geht der Frage nach, was Fake News sind und wie man sie erkennen kann. Kapitel: Was sind Fake News? Wer macht Fake News? Facebook und Fake News; Fake News in anderen Medien; Mit Falschnachrichten Geld verdienen; Falschnachrichten entlarven.
Ukraine-Krieg: So erkennt man Russlands Fake Videos
Vor der Invasion in der Ukraine verbreitete Russland zahlreiche gefälschte Videos, deren Inhalte als Kriegsgrund genommen wurden. Der Film zeigt, wie man sie anhand verschiedener Informationen und der Analyse der Metadaten als Fälschungen und Teil der russischen Desinformationskampagne identifizieren kann.
Krieg in der Ukraine: Warum interessiert sich Russland für die Ukraine?
Um zu verstehen, warum Putin einen Krieg mit der Ukraine führt, muss man die Bedeutung der Ukraine für Russland kennen. Putin sieht sie als festen Teil der russischen Identität und der russischen Sicherheit. Er nutzt den Mythos des „gemeinsamen Volkes“ zur Propaganda und als Rechtfertigung für seine aggressive Außenpolitik.
Manipulation von Bildern
An historischen und zeitgeschichtlichen Beispielen wird gezeigt, wie Politik und öffentliche Meinung durch die Manipulation von Bildern beeinflusst werden. Der Film geht dabei auf Beispiele aus dem Nationalsozialismus sowie der Sowjetunion und der DDR ein. Er zeigt auch manipulierte Bilder der Neuzeit in Zeitungen und Fernsehen. Ein eigenes Kapitel erläutert, welche Rolle in zwei Golfkriegen Bilder von angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak und ein von einer PR-Agentur inszeniertes Massaker in einem kuwaitischen Krankenhaus spielten. Der Film macht nicht nur Manipulationen sichtbar und sensibilisiert den kritischen Blick, er gibt auch praktische Tipps zur Medienkompetenz: Wer lanciert mit welchem Interesse Bilder? Wie erkenne ich die Seriosität von Quellen?
Lithium und Kobalt
Umweltfreundlich, sauber, nachhaltig: Elektromobilität gilt vielen als „Heilsbringer“. Doch die notwendigen Rohstoffe für die Akkus sind knapp und stammen oft aus zweifelhaften Quellen. Besonders die Förderung der Rohstoffe Lithium und Kobalt ist problematisch. Der Film berichtet aus Chile und der Demokratischen Republik Kongo, um zu zeigen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Folgen die Rohstoffe für die „Elektroauto-Revolution“ gewonnen werden.
In Chile stammt das Lithium aus Salzseen, den sogenannten Salares, in der Atacama-Wüste, eine der trockensten Gegenden der Welt. Die Lagunen sind die Heimat der Andenflamingos, die es nur hier gibt. Mit der großflächigen Gewinnung des Lithiums gehen ihre Lebensräume verloren; die Flamingos sind mittlerweile vom Aussterben bedroht. Zudem verbraucht die Gewinnung des Leichtmetalls extrem viel Wasser. Sinkende Grundwasserspiegel machen die Landwirtschaft der indigenen Bauern an den Ufern der Salzseen unmöglich.
In der Demokratische Republik Kongo wird Kobalt vorwiegend in großen Minen von internationalen Rohstoffkonzernen abgebaut. Rund ein Fünftel des Abbaus stammt jedoch aus illegalen, selbst erschlossenen Minen. In diesen Kleinminen, dem sogenannten „artisanalen Bergbau“, sind die Bedingungen oft kritisch: Häufig sind es schmale Schächte, die ohne Sicherung bis zu 45 Meter tief in die Erde gegraben werden. Kinderarbeit ist in vielen Minen alltäglich.
Was aber könnten sinnvolle Alternativen bei der Rohstoffbeschaffung und bei der Produktion von Auto-Akkus sein? Diesen Fragen geht der Film am Ulmer Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung und beim Lithiumabbau im Erzgebirge nach.
Werte einer freien, demokratischen Gesellschaft
Frei wählen! Sagen und schreiben, was man denkt! Respekt für sich und für andere! Jugendliche diskutieren in einem Workshop grundlegende Werte und Freiheiten unserer Gesellschaft: Demokratie, Grundrechte und Pluralismus.
Masel Tov Cocktail
Dimitrij Liebermann (19) ist Jude, Sohn russischer Einwanderer und er hat Tobi geschlagen. Dafür soll er sich entschuldigen. Nur leid tut es ihm nicht unbedingt. Auf dem Weg zu Tobi begegnet Dimitrij ein Querschnitt der deutschen Gesellschaft mit Vorurteilen und immer wieder ein Problem, das es auszuhandeln gilt: seine deutsch-jüdische Identität.
All inclusive
Urlaub auf Kreuzfahrtschiffen verbindet sorglose Freizeit mit maximalem Reisekomfort. Riesige schwimmende Hotels bringen tausende von Menschen in kurzer Zeit zu weltberühmten Sehenswürdigkeiten und Zielen. Und auch an Bord ist einiges los. Mit Sinn für Humor führt der Film eine straff organisierte Urlaubswelt vor Augen und stellt sie in Frage.
Rechte und Pflichten
In Spielszenen und mit Experteninterviews geht der Film den Fragen der Rechte und Pflichten von Jugendlichen nach: Welche Auswirkungen hat das Jugendschutzgesetz auf Jugendliche, wie lange sie unbegleitet ausgehen, wie lange sie sich in Gaststätten aufhalten dürfen, wann sie einen Mofaführerschein und wann einen PKW-Führerschein erwerben können?
Landtagswahlen
Bei den Landtagswahlen stimmen Bürgerinnen und Bürger über die Abgeordneten in ihrem Landesparlament ab. Es wird erklärt, wie eine Landtagswahl in der Regel abläuft und wer wählen darf.
Geschichte und Gegenwart der UNO
Fast täglich hört, sieht oder liest man in den Medien über die UNO: mal im Zusammenhang mit einer Friedensmission, mal als Initiatorin einer Klimakonferenz oder als Instanz, die Städte zu einem „Weltkulturerbe“ erklären. Die Nachrichten sind voll von Begriffen wie UNESCO, UNO-Blauhelmsoldaten oder UNO-Generalsekretär. Aber was verbirgt sich dahinter? Und wie hängt das alles zusammen?
Nationale Identität der Deutschen
Vielen Deutschen fällt es schwer ihre nationale Identität zu beschreiben. Die Produktion lässt hierzu Deutsche mit ganz unterschiedlichem Background zu Wort kommen und regt zur Diskussion an.
Hasskommentare und falsche Likes
In den sozialen Medien wird kräftig getrickst. Man kann alles kaufen, was Kunden im Netz erfolgreicher erscheinen lässt. Ein Unternehmen aus Hamburg beispielsweise vermittelt Likes, Kommentare und Klicks. Wer viel zahlt, kriegt auch viel künstliche Resonanz. Wenn es besonders schnell gehen soll, werden auch Social Bots eingesetzt.
Rechte und Pflichten von Jugendlichen
Die gesetzlich verankerten Rechte und Pflichten Jugendlicher stehen im Zentrum dieser aktualisierten Unterrichtseinheit.
Fake News
Gerade Jugendliche informieren sich häufig in sozialen Netzwerken oder Blogs über aktuelle Ereignisse und stoßen dabei auch auf sogenannte Fake News. Der Begriff ist derzeit in aller Munde – doch um was geht es hier eigentlich? Die Produktion vermittelt, was Fake News, Social Bots und Echokammern sind, wie dieses Prinzip funktioniert und wer davon profitiert. Zudem wird gezeigt, wie man Fake News erkennt und sich vor Manipulation schützen kann.
Bundestagswahl 2017 – BpB
Am 24. September 2017 fand die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. 61,5 Millionen Menschen wählten dann ihre Abgeordneten ins Parlament, rund drei Millionen von ihnen zum ersten Mal.
Deutschland – eine Mediendemokratie
Medien erfüllen wichtige Funktionen in der Demokratie und gelten als „vierte Gewalt“ im Staat. Politiker brauchen mediale Darstellung zur Vermittlung ihrer Politik. Doch wie stellen Medien Politik dar? Wer beeinflusst dabei eigentlich wen? Haben Medien zu viel Einfluss? Und ist Politik nur noch Inszenierung und Politainment? Die Produktion vermittelt die Grundlagen dieses Verhältnisses und thematisiert darüber hinaus aktuelle Entwicklungen durch die Neuen Medien.
Democracy
Der Film ermöglicht einen Einblick in den Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene. Eine Geschichte über eine Handvoll Politiker, die versucht, die Gesellschaft vor den Gefahren von Big Data und Massenüberwachung in der digitalen Welt zu schützen. Zweieinhalb Jahre lang wurden die Politiker Jan Philipp Albrecht und Viviane Reding begleitet, die sich unermüdlich einem harten, fast undurchdringlichen politischen Machtapparat stellen, der bestimmt wird von Intrigen, Erfolg und Scheitern. Die Dokumentation verdeutlicht die komplexe Mächte-Architektur sowie den Zustand der heutigen Demokratie.
Flucht aus Afrika
Die Flüchtlingskrise hält die Welt in Atem und nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Am Beispiel afrikanischer Flüchtlinge zeigt die Dokumentation, warum bereits Kinder und Jugendliche ihre Heimat verlassen und sich auf eine lebensgefährliche Reise begeben, die sie durch fremde Länder und über das Mittelmeer führt. Die zahllosen Bedrohungen, denen sie dabei ausgesetzt sind, werden vor Augen geführt. Auf diese Weise macht der Film das Ausmaß der Flüchtlingskatastrophe sichtbar und verdeutlicht die Motive der Menschen, die sich voller Hoffnung auf den Weg nach Europa machen.
Flüchtlinge in Deutschland
Immer mehr Menschen verlassen ihre Heimat und kommen als Flüchtlinge nach Deutschland. Wie reagieren der Staat und die Menschen in diesem Land? Sechs Kurzfilme dokumentieren die ganze Bandbreite des Themas.
Extrem Rechts!
Rechtsextremismus zeigt sich in Deutschland längst nicht mehr nur am politisch extremen Rand außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. Der Begriff Neonazismus versucht der Entwicklung gerecht zu werden und diskriminierende politische Bewegungen begrifflich abzubilden und einzuordnen. Hier werden sprachliche Definitionen verdeutlicht, neonazistische Strukturen aufgezeigt und erklärt, wie neonazistisches Gedankengut in der Gesellschaft verbreitet wird und sich so zu einer Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Staates entwickeln kann.
Klasse 11–12
Ökonomie und Ökologie
Die Produktion vermittelt grundlegende Informationen zum Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie. Sie greift dabei sowohl die Perspektive des Staates, der Industrie als auch der privaten Haushalte auf und zeigt anhand von Beispielen die Entwicklung einer ökologischen Wirtschaftsweise. Das unzureichende Paradigma des „Magischen Vierecks“ wird erläutert, wie auch das Dilemma, in dem sich die Politik nicht erst seit dem Moment befindet, als es zum „Magischen Sechseck“ erweitert wurde.
Ökologischer Fußabdruck
Es wird verdeutlicht, wie wir in den Bereichen Wohnen, Ernährung, Energieverbrauch, Mobilität, Konsum und Freizeit Flächen beanspruchen und Ressourcen verbrauchen. Beschrieben wird das wissenschaftliche Modell des biologischen Fußabdrucks und veranschaulicht, wie sich die Einheit des globalen Hektars zusammensetzt. Das Medium stellt zur Diskussion, wie jede und jeder dazu beitragen kann, dass Ressourcen geschont und gerechter verteilt werden und sich die Erde regenerieren kann.
Heimat - Zwischen Gefühl und Politik [interaktiv]
Das Medium bietet eine Betrachtung des Begriffes von Heimat im historischen sowie in verschiedenen aktuellen Kontexten. Diese differenzierte Betrachtung ermöglicht es, im Unterricht die Verwendung des Begriffes kritisch zu betrachten und eigene Positionen zu beziehen. In Zeiten zunehmender Globalisierung und Migration taucht der komplexe Begriff „Heimat" wieder vermehrt in aktuellen Debatten auf. Dabei wird er von verschiedenen Seiten vereinnahmt und teilweise auch missbraucht. Neben der Verwendung des Begriffes „Heimat“ auf Produkten des täglichen Lebens wird insbesondere die gesellschaftspolitische Wirkung des zunehmenden Gebrauchs auf Wahlplakaten konservativer und rechtsextremer Parteien und Gruppierungen thematisiert.
Armut in der Wohlstandsgesellschaft [interaktiv]
Es wird nachvollziehbar, dass es in unserer Wohlstandsgesellschaft keine Armut geben müsste, und die Fragen zu Wirksamkeit und Begrenzungen der staatlichen Maßnahmen werden so gestellt, dass Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert sind, Position zu beziehen und ihren Gerechtigkeitsbegriff zu hinterfragen. Das vielseitige und aspektreiche Arbeitsmaterial zielt dementsprechend nicht nur auf Wissensvermittlung, sondern möchte über Einfühlung und Perspektivwechsel Schülerinnen und Schüler zu sozialem Engagement anregen.
Kommunalpolitik
Kommunalpolitik wird in diesem Medium sehr anschaulich präsentiert. Der Film begleitet Jugendliche durch das Planspiel „Pimp your town“ im niedersächsischen Bad Bentheim. Dabei wird die Thematik durch häufigen Gegenschnitt von Sitzungen des Gemeinderates und den Sitzungen der Jugendlichen im Planspiel sehr plastisch und nachvollziehbar. Das Planspiel kann die Jugendlichen zur politischen Teilhabe motivieren.
Soziale Medien
Die Reportage stellt in kontroverser Form drei "Rich Kids" vor und lässt Psychologen und Eltern zu Wort kommen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Verhalten in sozialen Medien und auf die Ungleichverteilung von Wohlstand und Chancen. Die Persönlichkeit und die Aussagen der jungen Protagonisten fordern zum Formulieren des eigenen Standpunkts heraus.
Von der Kakaofrucht zur Schokolade
Schokolade zählt zu den beliebtesten Süßigkeiten. Aufgrund der niedrigen Weltmarktpreise für Kakao leben jedoch viele Produzenten in Westafrika unterhalb der Armutsgrenze. Folgen der Armut sind Kinderarbeit und zerstörte Regenwälder. Der Faire Handel und seine Ziele werden thematisiert.
Die neue ökologische Generation
Mit Aktionen, Blockaden und Besetzungen erlebt Deutschland Jahrzehnte nach der Friedensbewegung und der Anti-Atombewegung wieder eine große Protestwelle. Der Film stellt neue ökologische Bewegungen von "Fridays for Future" bis "Letzte Generation" vor, die auf unterschiedliche Weise versuchen, einen zügigen Wandel voranzutreiben, um die Klimakatastrophe doch noch einzudämmen und kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Er beleuchtet unter anderem den Aspekt der Klimagerechtigkeit und wirft die Frage auf, welche Methoden der Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen angemessen und zielführend sein können und wie weit der zivile Ungehorsam angesichts der Dringlichkeit der Lage gehen darf.
Orientierung an Werten
Der Film beschäftigt sich mit dem Boden, auf dem unsere Demokratien stehen. Ein fester Boden unserer Geschichte und Kultur. Die Basis für unsere Freiheit, Entfaltung und Schutz der Persönlichkeit und Freizügigkeit in Europa. Unter den Stichworten: Würde, Leben und Unversehrtheit, Rechts- und Sozialstaat, Gleichstellung, Persönlichkeits- und Bürgerrechte sowie Demokratie wird ein Querschnitt durch unseren Wertekanon abgebildet und die Bedeutung der Grundwerte an zahlreichen alltäglichen Beispielen sichtbar gemacht. Das Medium vermittelt auch den Rahmen durch europäische Verfassungen, Grund- und Menschenrechte, UN-Konventionen, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Europäische Menschenrechtskonvention. Es wird darauf eingegangen, dass diese Werte gegen zunehmend populistische, autoritäre und demokratiefeindliche Bewegungen und politische Akteure geschützt werden müssen. Ein Stilmittel des Mediums sind Fragestellungen beispielsweise nach einem Leben ohne diese Werte.
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Im Jahr 2015 beschlossen die Mitgliedsstaaten der UN die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. Ein Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise ist dringend notwendig. Dazu können wir alle beitragen, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verkleinern. Wir können aber auch unseren Handabdruck vergrößern, indem wir nachhaltiges Verhalten für möglichst viele Menschen einfacher machen. Wie das gelingen kann, zeigt der Film an einem Zero-Waste-Café, einem Unverpacktladen und einer Fairtrade-University.
Hongkong und Taiwan
Seit 2019 erschüttern Demonstrationen und Unruhen die einst so stabile Weltstadt Hongkong. Vor allem junge Hongkonger verlangen mehr demokratische Rechte. Immer mehr Einwohner Hongkongs gehen auf Distanz zur Volksrepublik China und eine Minderheit der Demonstranten provoziert China gar mit der Forderung nach Unabhängigkeit. Die wohl liberalste Gesellschaftsordnung in Asien genießen die 23 Mio. Bürger Taiwans. In den Augen Pekings ist Taiwan nur eine abtrünnige Provinz, die notfalls auch unter Waffengewalt mit dem Festland wiedervereinigt werden muss. Doch die Taiwanesen wollen weder ihre demokratischen Errungenschaften noch ihre Identität verlieren. Bei den Wahlen am 11. Januar 2020 erzielte die Chinakritische Präsidentin Tsai Ingwen einen deutlichen Sieg.
Spuren
Zwischen 2000 und 2007 ermordete die rechtsextreme Terrorgruppe NSU zehn Menschen, überwiegend türkische Migranten, die als Kleinunternehmer in Deutschland Fuß gefasst hatten. Der Dokumentarfilm lässt Hinterbliebene der Opfer ihre Erinnerungen teilen und erzählen, welche Spuren die Ermordeten hinterlassen haben.
Fakt oder Fake?
Informationen sind dank digitaler Medien überall und jederzeit verfügbar. Doch nicht alles, was geschrieben und gezeigt wird, ist wahr. Willi Weitzel geht der Frage nach, was Fake News sind und wie man sie erkennen kann. Kapitel: Was sind Fake News? Wer macht Fake News? Facebook und Fake News; Fake News in anderen Medien; Mit Falschnachrichten Geld verdienen; Falschnachrichten entlarven.
The Beauty
Die Fische treiben elegant im Wasser, die Muräne rekelt sich majestätisch in den zerklüfteten Unterwasserfelsen, die Seeanemonen werden von der Strömung hin- und hergetrieben. Der Betrachter wird von einem faszinierenden Unterwasser-Bilderkosmos regelrecht „eingelullt“. Doch ein genauer Blick auf die zu bewahrende „Schönheit“ zeigt, dass ein Fischschwarm nicht zwangsläufig aus Fischen bestehen muss.
Ukraine-Krieg: So erkennt man Russlands Fake Videos
Vor der Invasion in der Ukraine verbreitete Russland zahlreiche gefälschte Videos, deren Inhalte als Kriegsgrund genommen wurden. Der Film zeigt, wie man sie anhand verschiedener Informationen und der Analyse der Metadaten als Fälschungen und Teil der russischen Desinformationskampagne identifizieren kann.
Krieg in der Ukraine: Warum interessiert sich Russland für die Ukraine?
Um zu verstehen, warum Putin einen Krieg mit der Ukraine führt, muss man die Bedeutung der Ukraine für Russland kennen. Putin sieht sie als festen Teil der russischen Identität und der russischen Sicherheit. Er nutzt den Mythos des „gemeinsamen Volkes“ zur Propaganda und als Rechtfertigung für seine aggressive Außenpolitik.
Manipulation von Bildern
An historischen und zeitgeschichtlichen Beispielen wird gezeigt, wie Politik und öffentliche Meinung durch die Manipulation von Bildern beeinflusst werden. Der Film geht dabei auf Beispiele aus dem Nationalsozialismus sowie der Sowjetunion und der DDR ein. Er zeigt auch manipulierte Bilder der Neuzeit in Zeitungen und Fernsehen. Ein eigenes Kapitel erläutert, welche Rolle in zwei Golfkriegen Bilder von angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak und ein von einer PR-Agentur inszeniertes Massaker in einem kuwaitischen Krankenhaus spielten. Der Film macht nicht nur Manipulationen sichtbar und sensibilisiert den kritischen Blick, er gibt auch praktische Tipps zur Medienkompetenz: Wer lanciert mit welchem Interesse Bilder? Wie erkenne ich die Seriosität von Quellen?
Lithium und Kobalt
Umweltfreundlich, sauber, nachhaltig: Elektromobilität gilt vielen als „Heilsbringer“. Doch die notwendigen Rohstoffe für die Akkus sind knapp und stammen oft aus zweifelhaften Quellen. Besonders die Förderung der Rohstoffe Lithium und Kobalt ist problematisch. Der Film berichtet aus Chile und der Demokratischen Republik Kongo, um zu zeigen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Folgen die Rohstoffe für die „Elektroauto-Revolution“ gewonnen werden.
In Chile stammt das Lithium aus Salzseen, den sogenannten Salares, in der Atacama-Wüste, eine der trockensten Gegenden der Welt. Die Lagunen sind die Heimat der Andenflamingos, die es nur hier gibt. Mit der großflächigen Gewinnung des Lithiums gehen ihre Lebensräume verloren; die Flamingos sind mittlerweile vom Aussterben bedroht. Zudem verbraucht die Gewinnung des Leichtmetalls extrem viel Wasser. Sinkende Grundwasserspiegel machen die Landwirtschaft der indigenen Bauern an den Ufern der Salzseen unmöglich.
In der Demokratische Republik Kongo wird Kobalt vorwiegend in großen Minen von internationalen Rohstoffkonzernen abgebaut. Rund ein Fünftel des Abbaus stammt jedoch aus illegalen, selbst erschlossenen Minen. In diesen Kleinminen, dem sogenannten „artisanalen Bergbau“, sind die Bedingungen oft kritisch: Häufig sind es schmale Schächte, die ohne Sicherung bis zu 45 Meter tief in die Erde gegraben werden. Kinderarbeit ist in vielen Minen alltäglich.
Was aber könnten sinnvolle Alternativen bei der Rohstoffbeschaffung und bei der Produktion von Auto-Akkus sein? Diesen Fragen geht der Film am Ulmer Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung und beim Lithiumabbau im Erzgebirge nach.
Climate Warriors
Kriege und humanitäre Notstände stehen immer in Zusammenhang mit dem unstillbaren Energiehunger der Menschheit. Doch „Erneuerbare Energien“ könnten die Basis für ein friedlicheres Miteinander und die Bewahrung des Planeten darstellen. Wie kann man der Gier der Energiekonzerne trotzen und die Zukunft des Planeten sichern?
Wirtschaftskreislauf (Fassung 2020)
Die Modulfilme geben einen Einstieg in jeweils einen Teilaspekt des komplexen Kreislaufs der Wirtschaft. Das Medium gibt einen Überblick über die 5 verschiedenen sogenannten Wirtschaftssektoren (4 Inlandssektoren + Sektor „übrige Welt“).
Alle Modulfilme erläutern abstrakte Eigenschaften und Funktionen mit Hilfe von 3D-Computeranimationen, die in illustrierende bzw. beispielhafte Realsequenzen eingebettet sind.
Werte einer freien, demokratischen Gesellschaft
Frei wählen! Sagen und schreiben, was man denkt! Respekt für sich und für andere! Jugendliche diskutieren in einem Workshop grundlegende Werte und Freiheiten unserer Gesellschaft: Demokratie, Grundrechte und Pluralismus.
Masel Tov Cocktail
Dimitrij Liebermann (19) ist Jude, Sohn russischer Einwanderer und er hat Tobi geschlagen. Dafür soll er sich entschuldigen. Nur leid tut es ihm nicht unbedingt. Auf dem Weg zu Tobi begegnet Dimitrij ein Querschnitt der deutschen Gesellschaft mit Vorurteilen und immer wieder ein Problem, das es auszuhandeln gilt: seine deutsch-jüdische Identität.
All inclusive
Urlaub auf Kreuzfahrtschiffen verbindet sorglose Freizeit mit maximalem Reisekomfort. Riesige schwimmende Hotels bringen tausende von Menschen in kurzer Zeit zu weltberühmten Sehenswürdigkeiten und Zielen. Und auch an Bord ist einiges los. Mit Sinn für Humor führt der Film eine straff organisierte Urlaubswelt vor Augen und stellt sie in Frage.
Fakefinder
In einer Spielabfolge werden Nachrichten angezeigt, die unglaublich klingen: Ein Teil davon sind seriös, ein Teil ist Satire, ein Teil aber sind Fakenews.
Landtagswahlen
Bei den Landtagswahlen stimmen Bürgerinnen und Bürger über die Abgeordneten in ihrem Landesparlament ab. Es wird erklärt, wie eine Landtagswahl in der Regel abläuft und wer wählen darf.
Massentierhaltung
Der Film geht der Frage nach, unter welchen Bedingungen Tiere für die industrielle Verwertung gehalten werden. Welche Möglichkeiten hat man, auf diese Bedingungen Einfluss zu nehmen?
Zu gut für den Müll?
18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr in Deutschland auf dem Müll. Im Film wird nachgefragt, warum so viele gute Lebensmittel in den Containern der Supermärkte enden.
Geschichte und Gegenwart der UNO
Fast täglich hört, sieht oder liest man in den Medien über die UNO: mal im Zusammenhang mit einer Friedensmission, mal als Initiatorin einer Klimakonferenz oder als Instanz, die Städte zu einem „Weltkulturerbe“ erklären. Die Nachrichten sind voll von Begriffen wie UNESCO, UNO-Blauhelmsoldaten oder UNO-Generalsekretär. Aber was verbirgt sich dahinter? Und wie hängt das alles zusammen?
Nationale Identität der Deutschen
Vielen Deutschen fällt es schwer ihre nationale Identität zu beschreiben. Die Produktion lässt hierzu Deutsche mit ganz unterschiedlichem Background zu Wort kommen und regt zur Diskussion an.
Global Player
Was macht einen Konzern zum „Global Player“? Am Beispiel einer multinationalen Firma wird die Entwicklung vom kleinen Familienbetrieb bis zum weltweit tätigen Unternehmen verfolgt und deren Absichten, Vorteile und Schwierigkeiten ebenso wie der Einfluss der Globalisierung – auch für die Beschäftigten – genauer beleuchtet.
Hasskommentare und falsche Likes
In den sozialen Medien wird kräftig getrickst. Man kann alles kaufen, was Kunden im Netz erfolgreicher erscheinen lässt. Ein Unternehmen aus Hamburg beispielsweise vermittelt Likes, Kommentare und Klicks. Wer viel zahlt, kriegt auch viel künstliche Resonanz. Wenn es besonders schnell gehen soll, werden auch Social Bots eingesetzt.
10 Milliarden
Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf zehn Milliarden Menschen anwachsen. Doch wo soll die Nahrung für alle herkommen? Kann man Fleisch künstlich herstellen? Oder baut jeder bald seine eigene Nahrung an? Wie können wir verhindern, dass die Menschheit durch die hemmungslose Ausbeutung knapper Ressourcen die Grundlage für ihre Ernährung zerstört? Es wird mit Machern aus den gegnerischen Lagern der industriellen und der bäuerlichen Landwirtschaft gesprochen, es werden Biobauern und Nahrungsmittelspekulanten getroffen und Laborgärten und Fleischfabriken besucht.
Wie die Digitalisierung unsere Arbeitswelt verändert
Ob auf dem Acker, in der Fabrik, im Büro, im Pflegeheim oder im Operationssaal, kleine, intelligente Roboter und Computer werden zu „smarten“ Assistenten, aber auch zu unseren Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt. Digitale Nomaden und Clickworker haben keine festen Arbeitsorte, Arbeitszeiten oder Arbeitsverträge mehr. Wie können wir unsere künftige Arbeitswelt mitgestalten?
The Cleaners
Bitte um Beachtung: Wir empfehlen der Lehrkraft dringend, vor einem Unterrichtseinsatz den Film selbst anzusehen!
Der Film macht auf die Schattenindustrie digitaler Zensur in Manila, dem größten Outsourcing-Standort für Content Moderation, aufmerksam. Dort löschen zehntausend Menschen in 10-Stunden-Schichten belastende Fotos und Videos von Facebook, YouTube, Twitter & Co. Die Aufgaben dieser „Content Manager“ werden überwiegend von Arbeitern auf den Philippinen ausgeführt. In Sekundenschnelle müssen sie entscheiden welche Inhalte auf Internetplattformen veröffentlicht werden dürfen oder gegen die Richtlinien verstoßen.
Hinweise zum Jugendmedienschutz:
Der eindrucksvolle Dokumentarfilm „The Cleaners“ zeigt den bisher noch unbeachteten Beruf des Content-Moderators, der für die Internetdienste Facebook, Twitter und YouTube die hochgeladenen, oft zweifelhaften Videos und Bilder prüft. Hierbei bestimmen Content-Moderatoren maßgeblich mit, was die User dieser Seiten letztendlich zu sehen bekommen. Die Content-Moderatoren sichten dafür mitunter stundenlang pornographisches, gewaltverherrlichendes und hetzerisches Film- und Bildmaterial, was sich letztendlich auch auf ihre Psyche auswirkt. Der Film enthält daher Material, das für Schülerinnen und Schüler sehr verstörend wirken könnte: Bilder einer Enthauptung, Bilder von ertrunkenen Kindern, Videos von körperlicher Gewalt, Videos einer nachgestellten Kreuzigung und detailreiche Beschreibungen von sexuellen Übergriffen. Bereits die FSK Freigabe ab 16 Jahren erlaubt nur einen Einsatz in der Oberstufe. Aufgrund der intensiven Bilder wäre auch ein Einsatz des Filmes ausschließlich mit volljährigen Schülern bzw. nur ausgewählter Szenen denkbar."
Fake News
Gerade Jugendliche informieren sich häufig in sozialen Netzwerken oder Blogs über aktuelle Ereignisse und stoßen dabei auch auf sogenannte Fake News. Der Begriff ist derzeit in aller Munde – doch um was geht es hier eigentlich? Die Produktion vermittelt, was Fake News, Social Bots und Echokammern sind, wie dieses Prinzip funktioniert und wer davon profitiert. Zudem wird gezeigt, wie man Fake News erkennt und sich vor Manipulation schützen kann.
Bundestagswahl 2017 – BpB
Am 24. September 2017 fand die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. 61,5 Millionen Menschen wählten dann ihre Abgeordneten ins Parlament, rund drei Millionen von ihnen zum ersten Mal.
Democracy
Der Film ermöglicht einen Einblick in den Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene. Eine Geschichte über eine Handvoll Politiker, die versucht, die Gesellschaft vor den Gefahren von Big Data und Massenüberwachung in der digitalen Welt zu schützen. Zweieinhalb Jahre lang wurden die Politiker Jan Philipp Albrecht und Viviane Reding begleitet, die sich unermüdlich einem harten, fast undurchdringlichen politischen Machtapparat stellen, der bestimmt wird von Intrigen, Erfolg und Scheitern. Die Dokumentation verdeutlicht die komplexe Mächte-Architektur sowie den Zustand der heutigen Demokratie.
Das System Milch
Fast auf jeder Milchpackung sieht man das Bild glücklicher Kühe, doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Milch ist Big Business: hinter dem unschuldig anmutenden Lebensmittel verbirgt sich ein milliardenschweres Industriegeflecht. Der Film über die Welt der Milch wirft einen Blick hinter die Kulissen. Landwirte, Industrielle und Wissenschaftler beantworten, welch weitreichende Folgen das große Geschäft mit der Milch hat – auf die Tiere, die Umwelt und auf den Menschen. Besonders kleine Betriebe sind stark abhängig vom Milchpreis. Landwirte kämpfen ums Überleben, während globale Großkonzerne profitieren. Gleichzeitig werden Kühe durch Zucht immer weiter zweckoptimiert – bis hin zur Grenze der ethischen Vertretbarkeit. Diese Umstände werden angeprangert. Alternativen zu diesem ausbeutenden System werden aufgezeigt.
Konjunktur
Wirtschaftswachstum ist eine Voraussetzung für Vollbeschäftigung und der Königsweg in eine glückliche Wohlstandsgesellschaft, während andere vor den Folgen der mit dem Wachstum einhergehenden Lebens- und Konsumstile warnen. Die Kritiker beziehen sich auf den Begriff eines rein quantitativen Wachstums, das durch Steigerung des Konsums erreicht wird. Wachstum bedeutet zwar mehr Produktion, mehr Umsatz und mehr Gewinn, aber auch mehr Rohstoffverbrauch und mehr Umweltverschmutzung. Ein deutliches Zeichen für diese Art des Wirtschaftswachstums ist der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts, was wiederum meist positive Auswirkungen auf die Beschäftigung hat, leider aber ohne Rücksicht auf die soziale und natürliche Umwelt zustande kommt.
Diese Seite teilen: