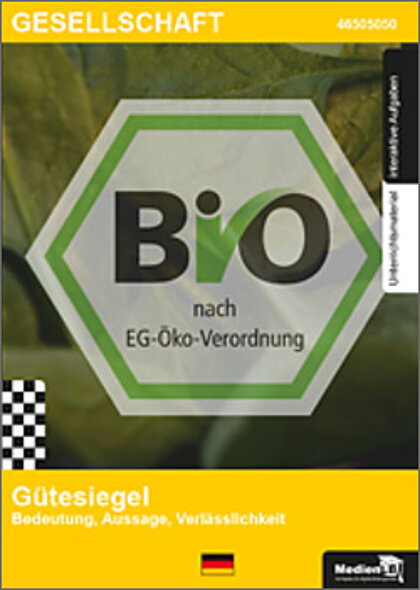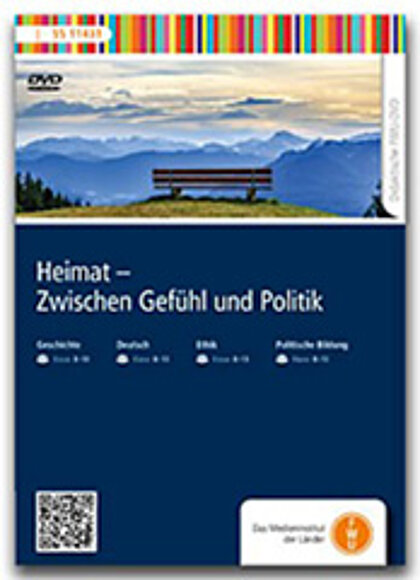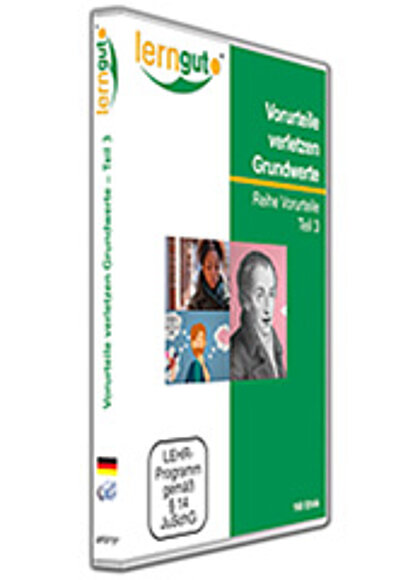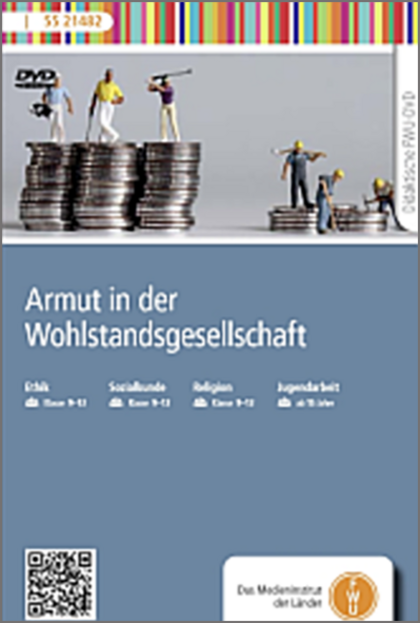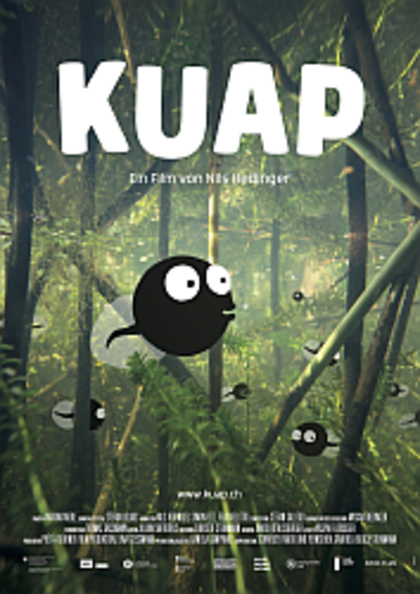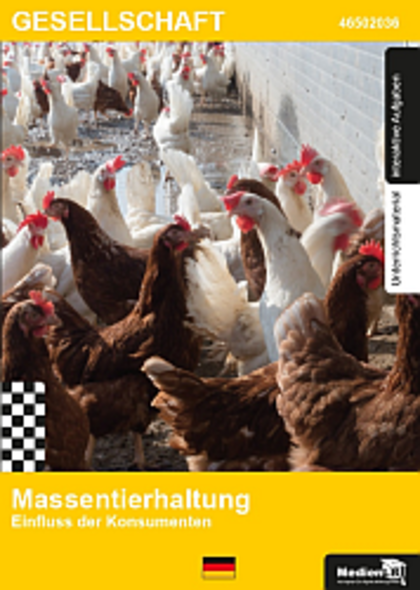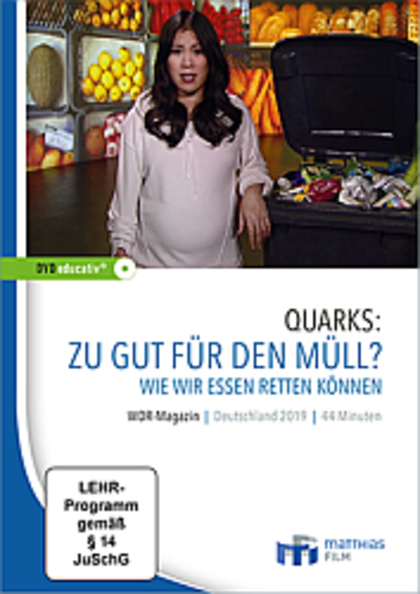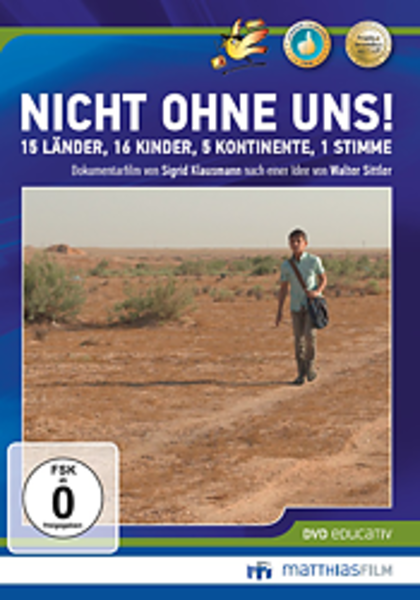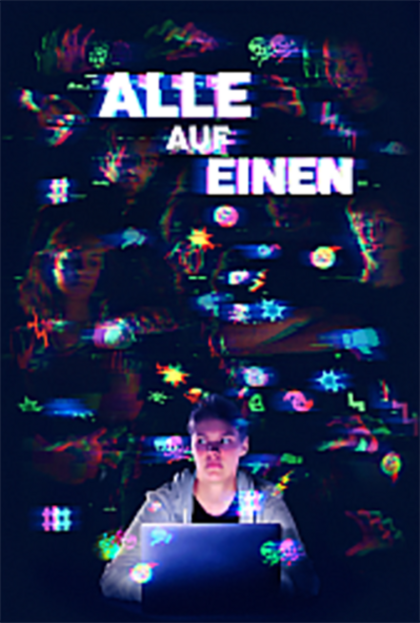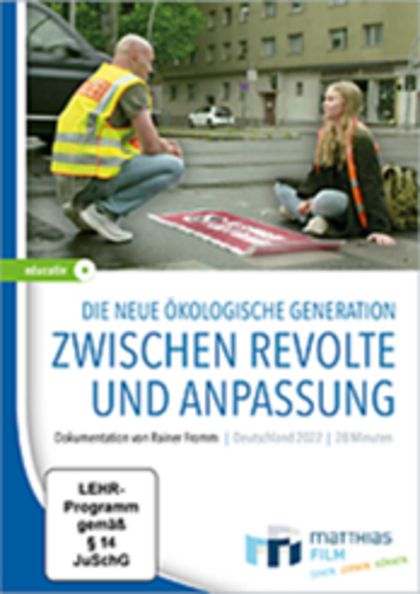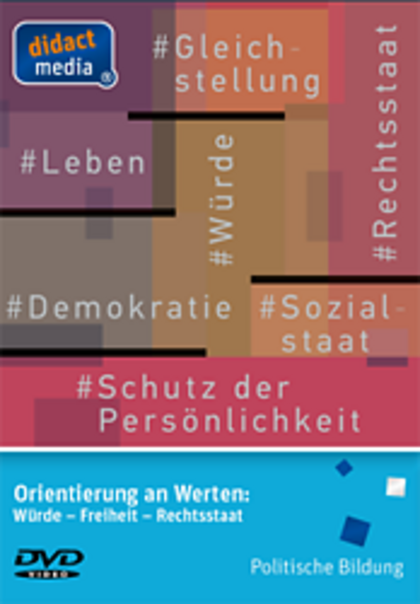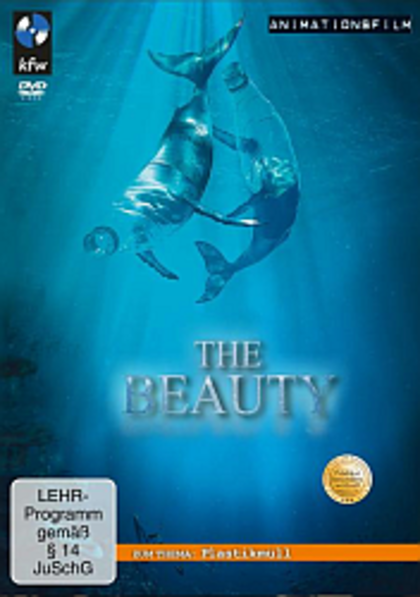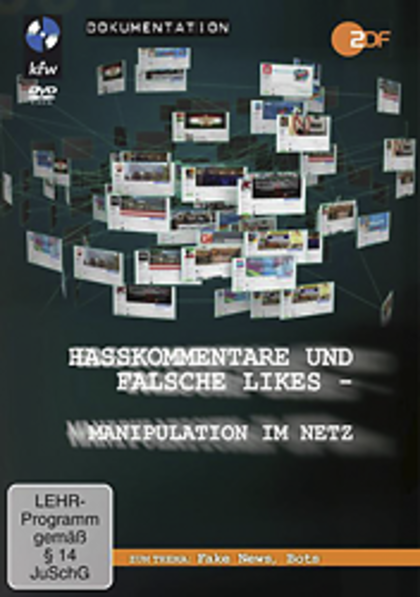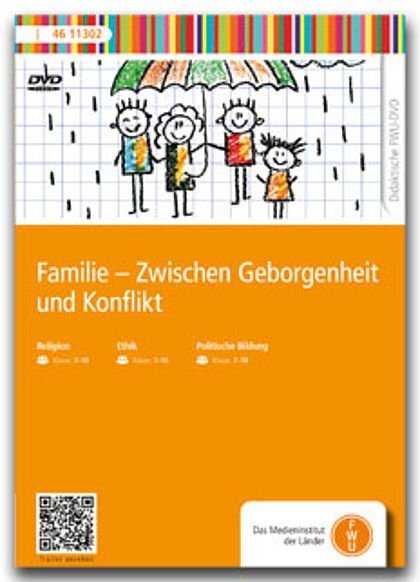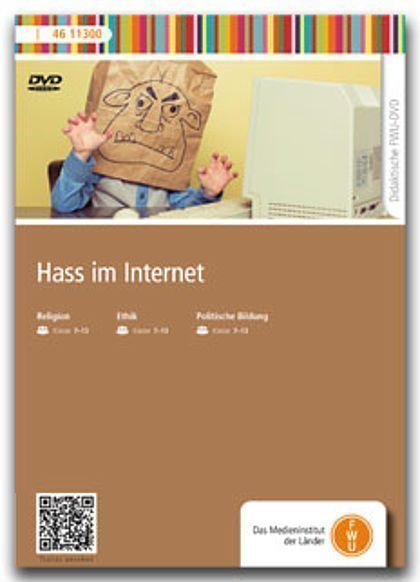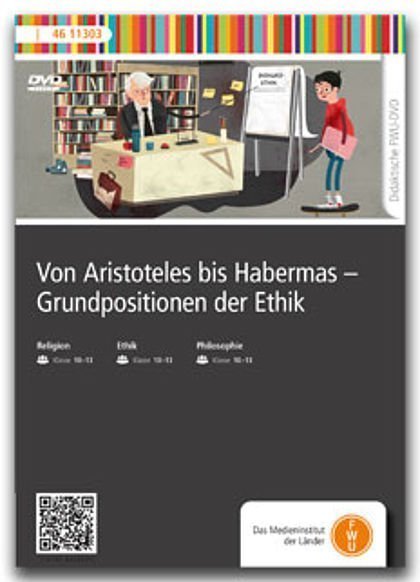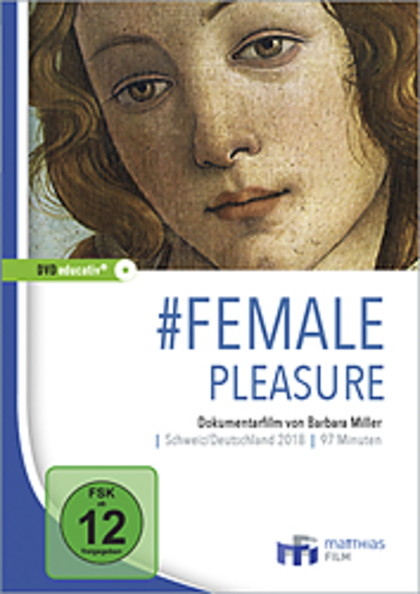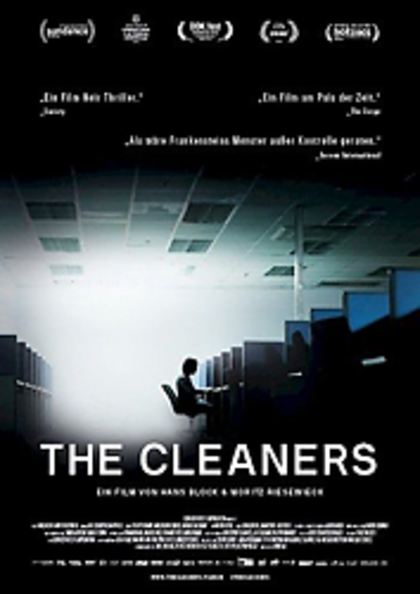Ethik
Alle hier aufgeführten Medien und Materialien sind von den zuständigen Fachkommissionen der Medienbegutachtung für den schulischen Einsatz besonders empfohlen.
Diese Auflistung stellt nur eine kleine Auswahl der empfohlenen Filme in der SESAM-Mediathek dar. Viele der hier vorgestellten Filme sind landesweit verfügbar – aber leider nicht alle. Es kann also passieren, dass in Ihrem Medienzentrum der ein oder andere Film nicht genutzt werden kann.
GettyImages/Pixelfit
Klasse 7–8
Wieder auf die Beine
Jugendliche reden offen über ihre Vulnerabilität und ihre Resilienz. Authentisch geben sie Einblicke in die von ihnen erlebten Krisen (wie z.B. Mobbing, Flucht, psychische Erkrankung, Tod, Corona, Kriege). Lernende können sich mit Gleichgesinnten identifizieren, ohne dabei innerhalb der Lerngruppe selbst Gefahr zu laufen, das Gesicht zu verlieren. Ganz besonders wertvoll sind die in den Filmen implizit vermittelten Handlungstipps.
Umwelt-Aktivismus und Klimagerechtigkeit
Jungen Klimaaktivisten bieten Identifikationsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler, um ihr eigenes Verhalten in Bezug auf die Klimakrise zu hinterfragen. Verschiedene offene und geschlossene Aufgabentypen auf Englisch knüpfen an das Thema an, wodurch sich Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten entwickeln, die weiter vertieft werden können. Der gesprochene Text des Mediums ist gut verständlich, aber anspruchsvoll und das thematische Vokabular sollte im Vorfeld vorentlastet werden.
Gütesiegel
Das Medienpaket thematisiert zunächst historische Hintergründe zur Einführung von Gütesiegel. Im Anschluss wird unter anderem anschaulich erläutert, welche Aussagen und Absichten generell hinter Gütesiegeln stecken können. Dabei wird kritisch und anschaulich beispielsweise auf Intransparenz und Verlässlichkeit von Gütesiegeln eingegangen. In einem weiteren Kapitel werden Beispiele bekannterer Gütesiegel, wie Blauer Engel, Bio, Fair Trade, vorgestellt und eingeordnet.
Heimat - Zwischen Gefühl und Politik [interaktiv]
Das Medium bietet eine Betrachtung des Begriffes von Heimat im historischen sowie in verschiedenen aktuellen Kontexten. Diese differenzierte Betrachtung ermöglicht es, im Unterricht die Verwendung des Begriffes kritisch zu betrachten und eigene Positionen zu beziehen. In Zeiten zunehmender Globalisierung und Migration taucht der komplexe Begriff „Heimat" wieder vermehrt in aktuellen Debatten auf. Dabei wird er von verschiedenen Seiten vereinnahmt und teilweise auch missbraucht. Neben der Verwendung des Begriffes „Heimat“ auf Produkten des täglichen Lebens wird insbesondere die gesellschaftspolitische Wirkung des zunehmenden Gebrauchs auf Wahlplakaten konservativer und rechtsextremer Parteien und Gruppierungen thematisiert.
Vorurteile verletzen Grundwerte
Anhand des Vorurteils "Alle Jugendlichen, die Computer spielen, sind faul" wird geprüft, inwiefern dieses Beispiel gegen die Grundwerte verstößt. In einer weiteren Übungsphase wird das Vorurteil "Alte Menschen sind unfreundlich" untersucht und die gelernten Grundwerte rekapituliert.
Der Bezug zu den Grundrechten, das Verständnis von Demokratie und Empathieempfinden macht das Medium für einen Einsatz im Unterricht sehr geeignet. Durch die angesprochenen Werte (Vernunft, Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit) bekommt die Diskussion über den Schaden durch Vorteile eine inhaltliche Tiefe, mit der alle prozessorientierten Kompetenzen gefördert werden können.
Armut in der Wohlstandsgesellschaft [interaktiv]
Es wird nachvollziehbar, dass es in unserer Wohlstandsgesellschaft keine Armut geben müsste, und die Fragen zu Wirksamkeit und Begrenzungen der staatlichen Maßnahmen werden so gestellt, dass Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert sind, Position zu beziehen und ihren Gerechtigkeitsbegriff zu hinterfragen. Das vielseitige und aspektreiche Arbeitsmaterial zielt dementsprechend nicht nur auf Wissensvermittlung, sondern möchte über Einfühlung und Perspektivwechsel Schülerinnen und Schüler zu sozialem Engagement anregen.
Soziale Medien
Die Reportage stellt in kontroverser Form drei "Rich Kids" vor und lässt Psychologen und Eltern zu Wort kommen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Verhalten in sozialen Medien und auf die Ungleichverteilung von Wohlstand und Chancen. Die Persönlichkeit und die Aussagen der jungen Protagonisten fordern zum Formulieren des eigenen Standpunkts heraus.
Schönheit digital
Das Medium bietet ein Haupt- und vier Teilmodule zu den wichtigsten Unterthemen im digitalen Umgang mit dem Konzept von Schönheit (Schönheitsideale und Social Media, Schönheitsideale durch Bildbearbeitung, Bodyshaming vs. Body Positivity, Diversität). Die interaktiven Arbeitsaufträge sind operatorengestützt und für verschiedene Sozialformen angelegt.
Fakt oder Fake?
Informationen sind dank digitaler Medien überall und jederzeit verfügbar. Doch nicht alles, was geschrieben und gezeigt wird, ist wahr. Willi Weitzel geht der Frage nach, was Fake News sind und wie man sie erkennen kann. Kapitel: Was sind Fake News? Wer macht Fake News? Facebook und Fake News; Fake News in anderen Medien; Mit Falschnachrichten Geld verdienen; Falschnachrichten entlarven.
Ein Dorf sieht schwarz
Frankreich 1975: Seyolo Zantoko ist Arzt und stammt aus dem Kongo. Als er einen Job in einem kleinen Kaff nördlich von Paris angeboten bekommt, beschließt er, mit seiner Familie umzuziehen. Sie erwarten Pariser Stadtleben, treffen aber auf Dorfbewohner, die zum ersten Mal in ihrem Leben einem afrikanischen Arzt begegnen und alles tun, um den „Exoten“ das Leben schwer zu machen.
Kuap
Eine Kaulquappe verpasst die Entwicklung zum Frosch und bleibt alleine zurück, doch im Weiher gibt es viel zu erleben und der nächste Frühling kommt bestimmt. Eine kleine Geschichte über das Großwerden.
Social Media – Kompetenzen für die digitale Welt
Folgende Themenfelder werden behandelt: Social Media Basics, Datenschutz, Influencer, Fake News, Hate Speech, Cybermobbing, Extremismus und Populismus.
Massentierhaltung
Der Film geht der Frage nach, unter welchen Bedingungen Tiere für die industrielle Verwertung gehalten werden. Welche Möglichkeiten hat man, auf diese Bedingungen Einfluss zu nehmen?
Zu gut für den Müll?
18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr in Deutschland auf dem Müll. Im Film wird nachgefragt, warum so viele gute Lebensmittel in den Containern der Supermärkte enden.
Nikotin
Rauchen war lange Zeit voll in unserer Gesellschaft integriert. Egal ob im Kino, im Flugzeug oder in der Talkshow – überall durfte man rauchen. Rauchen war schließlich „cool“. Doch dieses Bild hat sich mittlerweile bei vielen geändert. Denn Rauchen birgt zahlreiche gesundheitliche Gefahren.
Nicht ohne uns!
Wie sehen Kinder die Welt und wie sieht ihre Welt aus? Welche Träume und Wünsche haben sie? Und welche Ängste und Sorgen? In der Dokumentation werden 16 Kinder aus 15 Ländern und fünf Kontinenten zu Themen, die sie beschäftigen, befragt. Ziel ist es, Kindern auf der ganzen Welt eine Stimme zu geben. Dazu werden die Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren in ihrem Lebensalltag begleitet. Die Kinder beantworten in Interviews Fragen zu Familie, Schule, Gesellschaft und ihrer Zukunft. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebensbedingungen und Persönlichkeiten verbindet alle Kinder ein gemeinsames Ziel.
Butterfly Circus
Amerika zur Zeit der Weltwirtschaftskrise: Der berühmte „Butterfly Circus“ reist unter der Leitung von Zirkusdirektor Mr. Mendez von Stadt zu Stadt. Ihr Ziel: Den Menschen inmitten von Unsicherheiten und allgemeiner Niedergeschlagenheit Freude und neue Hoffnung zu bringen. Bei seinen Reisen durchs Land trifft er auf einem Rummel auf Will, einen jungen Mann, der weder Arme noch Beine hat und gezwungen ist, als „Rarität“ in einer Freakshow seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nach Jahren der Demütigung wird Will von Mendez in den „Butterfly Circus“ aufgenommen. Dort erfährt er zum ersten Mal in seinem Leben Wertschätzung. Und er entdeckt ungeahnte Fähigkeiten, die seinem Leben Sinn und ihm selbst neue Hoffnung geben.
Klasse 9–10
Fünfzehn Zimmer
Im Hospiz wird gelebt bis zum letzten Tag. Ob die Schwiegermutter nervt, ein Stofftier Zärtlichkeit spendet oder ob verpasste Gelegenheiten Wehmut auslösen - Danka erlebt das täglich, wenn sie die 15 Zimmer über den Dächern Berlin Neuköllns sauber macht. Der Dokumentarfilm lässt Schüler*innen durch seine atmosphärisch treffende Machart sehr viel selber entdecken. Das verspricht bei diesem schweren Thema erhebliche Bildungsgewinne.
Dolapo is fine [OmU]
Der sehenswerte Kurzfilm besticht durch seine sehr gute filmische Inszenierung und durch eine tiefgründige Handlung. Mögliche Diskussions- bzw. Analysethemen sind unter anderem die Frage der kulturellen Identität, Selbstfindung, Aussehen, Diskriminierung, Anpassung oder auch die Frage nach Zielen im Leben. Der Film kann im Ethik- oder Englischunterricht eingesetzt werden, aber auch zur Filmanalyse im Kunstunterricht.
For Future 2
Die 15 umweltpolitischen Kurzfilme behandeln die Schwerpunkte Tierwohl, Umweltzerstörung, Klimapolitik, nachhaltiges Handeln und Konsum. Ehrlich reflektieren junge Menschen in den Filmen ihr starkes Umweltbewusstsein. Es kann erarbeitet werden, welchen Mehrwert die Aktivisten und Aktivistinnen aus ihren Aktionen für ihr eigenes Leben ziehen und ob die gezeigten Aktionen geeignet sind, auch politisch etwas zu bewegen.
Gütesiegel
Das Medienpaket thematisiert zunächst historische Hintergründe zur Einführung von Gütesiegel. Im Anschluss wird unter anderem anschaulich erläutert, welche Aussagen und Absichten generell hinter Gütesiegeln stecken können. Dabei wird kritisch und anschaulich beispielsweise auf Intransparenz und Verlässlichkeit von Gütesiegeln eingegangen. In einem weiteren Kapitel werden Beispiele bekannterer Gütesiegel, wie Blauer Engel, Bio, Fair Trade, vorgestellt und eingeordnet.
Armut in der Wohlstandsgesellschaft [interaktiv]
Es wird nachvollziehbar, dass es in unserer Wohlstandsgesellschaft keine Armut geben müsste, und die Fragen zu Wirksamkeit und Begrenzungen der staatlichen Maßnahmen werden so gestellt, dass Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert sind, Position zu beziehen und ihren Gerechtigkeitsbegriff zu hinterfragen. Das vielseitige und aspektreiche Arbeitsmaterial zielt dementsprechend nicht nur auf Wissensvermittlung, sondern möchte über Einfühlung und Perspektivwechsel Schülerinnen und Schüler zu sozialem Engagement anregen.
Alle auf einen
Diskriminierung im Internet verbreitet sich immer mehr, besonders in sozialen Netzwerken, Foren und Kommentarspalten. Doch wie ordnen junge Menschen den aggressiven Umgangston, Beleidigungen und Diffamierungen in der Netzsprache ein? Die manchmal sehr konträren Ansichten der interviewten Jugendlichen im Hinblick auf Netiquette versus Hate bieten einen guten Gesprächsanlass.
Soziale Medien
Die Reportage stellt in kontroverser Form drei "Rich Kids" vor und lässt Psychologen und Eltern zu Wort kommen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Verhalten in sozialen Medien und auf die Ungleichverteilung von Wohlstand und Chancen. Die Persönlichkeit und die Aussagen der jungen Protagonisten fordern zum Formulieren des eigenen Standpunkts heraus.
Die neue ökologische Generation
Mit Aktionen, Blockaden und Besetzungen erlebt Deutschland Jahrzehnte nach der Friedensbewegung und der Anti-Atombewegung wieder eine große Protestwelle. Der Film stellt neue ökologische Bewegungen von "Fridays for Future" bis "Letzte Generation" vor, die auf unterschiedliche Weise versuchen, einen zügigen Wandel voranzutreiben, um die Klimakatastrophe doch noch einzudämmen und kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Er beleuchtet unter anderem den Aspekt der Klimagerechtigkeit und wirft die Frage auf, welche Methoden der Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen angemessen und zielführend sein können und wie weit der zivile Ungehorsam angesichts der Dringlichkeit der Lage gehen darf.
Orientierung an Werten
Der Film beschäftigt sich mit dem Boden, auf dem unsere Demokratien stehen. Ein fester Boden unserer Geschichte und Kultur. Die Basis für unsere Freiheit, Entfaltung und Schutz der Persönlichkeit und Freizügigkeit in Europa. Unter den Stichworten: Würde, Leben und Unversehrtheit, Rechts- und Sozialstaat, Gleichstellung, Persönlichkeits- und Bürgerrechte sowie Demokratie wird ein Querschnitt durch unseren Wertekanon abgebildet und die Bedeutung der Grundwerte an zahlreichen alltäglichen Beispielen sichtbar gemacht. Das Medium vermittelt auch den Rahmen durch europäische Verfassungen, Grund- und Menschenrechte, UN-Konventionen, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Europäische Menschenrechtskonvention. Es wird darauf eingegangen, dass diese Werte gegen zunehmend populistische, autoritäre und demokratiefeindliche Bewegungen und politische Akteure geschützt werden müssen. Ein Stilmittel des Mediums sind Fragestellungen beispielsweise nach einem Leben ohne diese Werte.
Merkmale einer Verschwörungstheorie
Das Medium widmet sich den Fragestellungen: Wie funktionieren Verschwörungstheorien? Warum glauben Menschen an Verschwörungsmythen? Welche Rolle spielt das Internet bei der Verbreitung? Welche Interessen stecken dahinter? Worin bestehen konkret die Gefahren – wie Antisemitismus und Antipluralismus?
Vorgestellt werden historische und aktuelle Verschwörungsgeschichten: von den angeblichen jüdischen Brunnenvergiftern im Mittelalter über die Dolchstoßlegende zum Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Leugnung der Mondlandung oder der sogenannten „Bielefeld-Verschwörung“ in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es hinterfragt auch die jüngsten Mythen zu „Chemtrails“, „Adrenochrom“, „Umvolkung“ oder die Leugnung der Existenz der Bundesrepublik Deutschland oder des Corona-Virus. Es wird auf die Urheber, Trittbrettfahrer und Nutznießer von Verschwörungstheorien hingewiesen und auf Bewegungen wie die „Reichsbürger“ oder die „Querdenker“ sowie auf deren ideologischen Unterbau eingegangen. Die Vernetzung und Wiederholung der Verschwörungsgeschichten und der immer wiederkehrende Antisemitismus darin werden beleuchtet.
The Beauty
Die Fische treiben elegant im Wasser, die Muräne rekelt sich majestätisch in den zerklüfteten Unterwasserfelsen, die Seeanemonen werden von der Strömung hin- und hergetrieben. Der Betrachter wird von einem faszinierenden Unterwasser-Bilderkosmos regelrecht „eingelullt“. Doch ein genauer Blick auf die zu bewahrende „Schönheit“ zeigt, dass ein Fischschwarm nicht zwangsläufig aus Fischen bestehen muss.
Ein Dorf sieht schwarz
Frankreich 1975: Seyolo Zantoko ist Arzt und stammt aus dem Kongo. Als er einen Job in einem kleinen Kaff nördlich von Paris angeboten bekommt, beschließt er, mit seiner Familie umzuziehen. Sie erwarten Pariser Stadtleben, treffen aber auf Dorfbewohner, die zum ersten Mal in ihrem Leben einem afrikanischen Arzt begegnen und alles tun, um den „Exoten“ das Leben schwer zu machen.
Masel Tov Cocktail
Dimitrij Liebermann (19) ist Jude, Sohn russischer Einwanderer und er hat Tobi geschlagen. Dafür soll er sich entschuldigen. Nur leid tut es ihm nicht unbedingt. Auf dem Weg zu Tobi begegnet Dimitrij ein Querschnitt der deutschen Gesellschaft mit Vorurteilen und immer wieder ein Problem, das es auszuhandeln gilt: seine deutsch-jüdische Identität.
Social Media – Kompetenzen für die digitale Welt
Folgende Themenfelder werden behandelt: Social Media Basics, Datenschutz, Influencer, Fake News, Hate Speech, Cybermobbing, Extremismus und Populismus.
Der Tatortreiniger
Der Chef einer Consulting-Firma findet ein sadistisches Vergnügen daran, seine Mitarbeiter zu demütigen. Schotty gerät mit dem Chef aneinander und wird in eine Diskussion über Arbeit und Würde verwickelt. Zunächst wird Schotty verunsichert – bis er den Spieß umdreht.
Zu gut für den Müll?
18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr in Deutschland auf dem Müll. Im Film wird nachgefragt, warum so viele gute Lebensmittel in den Containern der Supermärkte enden.
Keine Angst vorm schwarzen Mann
Der Dokumentarfilm wirft ein Licht auf die Integration durch Sport und das Vorbeugen von Rassismus im Alltag. Im Zentrum stehen neben Assan Jallow z.B. der ehemalige Nationalspieler Patrick Owomoyela, der Integrationsbeauftragte des DFB Cacau, der Fan-Beauftragte Daniel Lörcher und äußern sich zu Integration, Sport und Rassismus.
Play
Die 17-jährige Jennifer ist gerade mit ihren Eltern umgezogen. Sie flüchtet sie sich in die virtuelle Spielewelt „Avalonia“. Schließlich verschmelzen Spiel und Realität so sehr, dass sie ihren Vater für einen Spielgegner hält und ihn schwer verletzt.
Die Hälfte der Welt gehört uns
Dokudrama über den Kampf engagierter Frauen aus Europa für das Wahlrecht: Marie Juchacz, Anita Augspurg, Emmeline Pankhurst und Marguerite Durand. Für ihr politisches Engagement wurden sie verspottet, eingesperrt und gefoltert. Gemeinsam standen sie an der Spitze des Kampfes tausender Frauen um Gleichberechtigung – quer durch Europa.
Hasskommentare und falsche Likes
In den sozialen Medien wird kräftig getrickst. Man kann alles kaufen, was Kunden im Netz erfolgreicher erscheinen lässt. Ein Unternehmen aus Hamburg beispielsweise vermittelt Likes, Kommentare und Klicks. Wer viel zahlt, kriegt auch viel künstliche Resonanz. Wenn es besonders schnell gehen soll, werden auch Social Bots eingesetzt.
Wie die Digitalisierung unsere Arbeitswelt verändert
Ob auf dem Acker, in der Fabrik, im Büro, im Pflegeheim oder im Operationssaal, kleine, intelligente Roboter und Computer werden zu „smarten“ Assistenten, aber auch zu unseren Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt. Digitale Nomaden und Clickworker haben keine festen Arbeitsorte, Arbeitszeiten oder Arbeitsverträge mehr. Wie können wir unsere künftige Arbeitswelt mitgestalten?
Lösch Dich! So organisiert ist der Hate im Netz – Rayk Anders
Die Dokumentation verfolgt ein Team, das „undercover“ als Trolle und Hater im Netz unterwegs war und berichtet von gesteuerten Shitstorms, Mobbingattacken und Wahlmanipulationen in der Szene.
Familie – Zwischen Geborgenheit und Konflikt
Familienleben im 21. Jahrhundert ist von einer großen Vielfalt an Lebensentwürfen geprägt. Die Produktion porträtiert drei unterschiedliche Familien und stellt sowohl deren Alltag als auch damit einhergehende Herausforderungen dar. Thematisiert wird unter anderem das Spannungsfeld zwischen Geborgenheit und Konflikt, Familienformen der Gegenwart, Rollenbilder, Regeln im familiären Zusammenleben sowie die Bedeutung religiöser Überzeugungen. Ergänzend veranschaulicht ein historischer Überblick die Entwicklung der Familie von der Antike bis heute.
Hass im Internet
Hasskommentare überfluten das Internet und die sozialen Netzwerke. Der Film Hass im „Internet“ porträtiert vier Personen, die solchen Angriffen ausgesetzt sind und zeigt, wie sie sich dagegen zur Wehr setzen. Dabei kommen auch die strafrechtlichen Folgen zur Sprache, die unbedachte Äußerungen nach sich ziehen können. Unterstützt durch umfangreiches Unterrichtsmaterial werden konkrete Handlungsmöglichkeiten gegen Hass im Netz aufgezeigt, aber auch die Probleme im Umgang mit der Online-Hetze diskutiert.
Von Aristoteles bis Habermas – Grundpositionen der Ethik
Auf dem Weg zum Erwachsensein erfahren Jugendliche: Es gibt Situationen, in denen gibt es kein eindeutiges „Richtig“ oder „Falsch“. Gleichzeitig trägt es zum gelingenden Zusammenleben in der Gesellschaft bei, die Begründungsmuster hinter dem Handeln anderer zu reflektieren und Taten vor diesem Hintergrund einzuordnen. In der Produktion wird deutlich, dass unterschiedliche Grundpositionen philosophischer Ethik dabei zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Ob Aristoteles, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, John Stuart Mill und Jürgen Habermas sich als gute Ratgeber für die Praxis erweisen? Mithilfe ihrer Ansätze können eigene Maßstäbe bewusstgemacht und durch Hinterfragung die eigene moralische Entwicklung gefördert werden.
Klasse 11–12
Alle auf einen
Diskriminierung im Internet verbreitet sich immer mehr, besonders in sozialen Netzwerken, Foren und Kommentarspalten. Doch wie ordnen junge Menschen den aggressiven Umgangston, Beleidigungen und Diffamierungen in der Netzsprache ein? Die manchmal sehr konträren Ansichten der interviewten Jugendlichen im Hinblick auf Netiquette versus Hate bieten einen guten Gesprächsanlass.
Die neue ökologische Generation
Mit Aktionen, Blockaden und Besetzungen erlebt Deutschland Jahrzehnte nach der Friedensbewegung und der Anti-Atombewegung wieder eine große Protestwelle. Der Film stellt neue ökologische Bewegungen von "Fridays for Future" bis "Letzte Generation" vor, die auf unterschiedliche Weise versuchen, einen zügigen Wandel voranzutreiben, um die Klimakatastrophe doch noch einzudämmen und kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Er beleuchtet unter anderem den Aspekt der Klimagerechtigkeit und wirft die Frage auf, welche Methoden der Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen angemessen und zielführend sein können und wie weit der zivile Ungehorsam angesichts der Dringlichkeit der Lage gehen darf.
Orientierung an Werten
Der Film beschäftigt sich mit dem Boden, auf dem unsere Demokratien stehen. Ein fester Boden unserer Geschichte und Kultur. Die Basis für unsere Freiheit, Entfaltung und Schutz der Persönlichkeit und Freizügigkeit in Europa. Unter den Stichworten: Würde, Leben und Unversehrtheit, Rechts- und Sozialstaat, Gleichstellung, Persönlichkeits- und Bürgerrechte sowie Demokratie wird ein Querschnitt durch unseren Wertekanon abgebildet und die Bedeutung der Grundwerte an zahlreichen alltäglichen Beispielen sichtbar gemacht. Das Medium vermittelt auch den Rahmen durch europäische Verfassungen, Grund- und Menschenrechte, UN-Konventionen, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Europäische Menschenrechtskonvention. Es wird darauf eingegangen, dass diese Werte gegen zunehmend populistische, autoritäre und demokratiefeindliche Bewegungen und politische Akteure geschützt werden müssen. Ein Stilmittel des Mediums sind Fragestellungen beispielsweise nach einem Leben ohne diese Werte.
Masel Tov Cocktail
Dimitrij Liebermann (19) ist Jude, Sohn russischer Einwanderer und er hat Tobi geschlagen. Dafür soll er sich entschuldigen. Nur leid tut es ihm nicht unbedingt. Auf dem Weg zu Tobi begegnet Dimitrij ein Querschnitt der deutschen Gesellschaft mit Vorurteilen und immer wieder ein Problem, das es auszuhandeln gilt: seine deutsch-jüdische Identität.
All inclusive
Urlaub auf Kreuzfahrtschiffen verbindet sorglose Freizeit mit maximalem Reisekomfort. Riesige schwimmende Hotels bringen tausende von Menschen in kurzer Zeit zu weltberühmten Sehenswürdigkeiten und Zielen. Und auch an Bord ist einiges los. Mit Sinn für Humor führt der Film eine straff organisierte Urlaubswelt vor Augen und stellt sie in Frage.
Zu gut für den Müll?
18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr in Deutschland auf dem Müll. Im Film wird nachgefragt, warum so viele gute Lebensmittel in den Containern der Supermärkte enden.
#Female pleasure
Offen zeigt der Film die unterschiedlichen Lebenswelten von fünf Frauen aus New York, Somalia, Japan, Deutschland und Indien, die sich mutig, klug und lustvoll gegen strukturelle sexualisierte Gewalt und Diskriminierung zu Wehr setzen. Der Film spürt den Fragen nach: Wie werden Frauen, wie wird weibliche Sexualität, wie wird der weibliche Körper heute auf der ganzen Welt dargestellt?
Die Hälfte der Welt gehört uns
Dokudrama über den Kampf engagierter Frauen aus Europa für das Wahlrecht: Marie Juchacz, Anita Augspurg, Emmeline Pankhurst und Marguerite Durand. Für ihr politisches Engagement wurden sie verspottet, eingesperrt und gefoltert. Gemeinsam standen sie an der Spitze des Kampfes tausender Frauen um Gleichberechtigung – quer durch Europa.
Der Sinn des Lebens
Die Nachricht vom nahen Weltende verändert das eintönige Leben eines älteren Paares grundlegend. Mit einem Mal sieht der Protagonist Walter die Welt neu und sich selbst mit existenziellen Fragen konfrontiert. Wie sollen er und seine Frau ihre letzten Stunden verbringen? Welche Lebenschancen haben sie verpasst?
MEGATRICK (ca. 2 min): Der Film zeigt, dass die eigenen Lebensziele nur allzu oft vom Leben selbst konterkariert werden.
Lösch Dich! So organisiert ist der Hate im Netz – Rayk Anders
Die Dokumentation verfolgt ein Team, das „undercover“ als Trolle und Hater im Netz unterwegs war und berichtet von gesteuerten Shitstorms, Mobbingattacken und Wahlmanipulationen in der Szene.
The Cleaners
Bitte um Beachtung: Wir empfehlen der Lehrkraft dringend, vor einem Unterrichtseinsatz den Film selbst anzusehen!
Der Film macht auf die Schattenindustrie digitaler Zensur in Manila, dem größten Outsourcing-Standort für Content Moderation, aufmerksam. Dort löschen zehntausend Menschen in 10-Stunden-Schichten belastende Fotos und Videos von Facebook, YouTube, Twitter & Co. Die Aufgaben dieser „Content Manager“ werden überwiegend von Arbeitern auf den Philippinen ausgeführt. In Sekundenschnelle müssen sie entscheiden welche Inhalte auf Internetplattformen veröffentlicht werden dürfen oder gegen die Richtlinien verstoßen.
Hinweise zum Jugendmedienschutz:
Der eindrucksvolle Dokumentarfilm „The Cleaners“ zeigt den bisher noch unbeachteten Beruf des Content-Moderators, der für die Internetdienste Facebook, Twitter und YouTube die hochgeladenen, oft zweifelhaften Videos und Bilder prüft. Hierbei bestimmen Content-Moderatoren maßgeblich mit, was die User dieser Seiten letztendlich zu sehen bekommen. Die Content-Moderatoren sichten dafür mitunter stundenlang pornographisches, gewaltverherrlichendes und hetzerisches Film- und Bildmaterial, was sich letztendlich auch auf ihre Psyche auswirkt. Der Film enthält daher Material, das für Schülerinnen und Schüler sehr verstörend wirken könnte: Bilder einer Enthauptung, Bilder von ertrunkenen Kindern, Videos von körperlicher Gewalt, Videos einer nachgestellten Kreuzigung und detailreiche Beschreibungen von sexuellen Übergriffen. Bereits die FSK Freigabe ab 16 Jahren erlaubt nur einen Einsatz in der Oberstufe. Aufgrund der intensiven Bilder wäre auch ein Einsatz des Filmes ausschließlich mit volljährigen Schülern bzw. nur ausgewählter Szenen denkbar."
Hass im Internet
Hasskommentare überfluten das Internet und die sozialen Netzwerke. Der Film Hass im „Internet“ porträtiert vier Personen, die solchen Angriffen ausgesetzt sind und zeigt, wie sie sich dagegen zur Wehr setzen. Dabei kommen auch die strafrechtlichen Folgen zur Sprache, die unbedachte Äußerungen nach sich ziehen können. Unterstützt durch umfangreiches Unterrichtsmaterial werden konkrete Handlungsmöglichkeiten gegen Hass im Netz aufgezeigt, aber auch die Probleme im Umgang mit der Online-Hetze diskutiert.
Von Aristoteles bis Habermas – Grundpositionen der Ethik
Auf dem Weg zum Erwachsensein erfahren Jugendliche: Es gibt Situationen, in denen gibt es kein eindeutiges „Richtig“ oder „Falsch“. Gleichzeitig trägt es zum gelingenden Zusammenleben in der Gesellschaft bei, die Begründungsmuster hinter dem Handeln anderer zu reflektieren und Taten vor diesem Hintergrund einzuordnen. In der Produktion wird deutlich, dass unterschiedliche Grundpositionen philosophischer Ethik dabei zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Ob Aristoteles, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, John Stuart Mill und Jürgen Habermas sich als gute Ratgeber für die Praxis erweisen? Mithilfe ihrer Ansätze können eigene Maßstäbe bewusstgemacht und durch Hinterfragung die eigene moralische Entwicklung gefördert werden.
Diese Seite teilen: